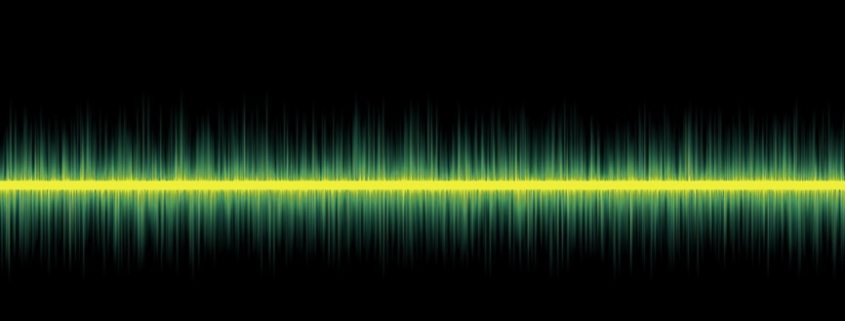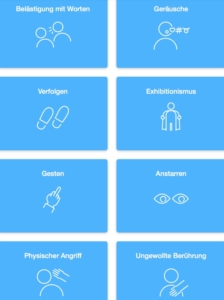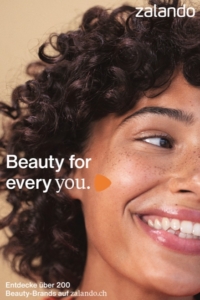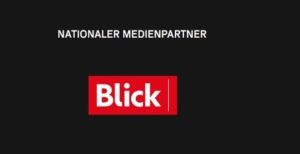Auf den Kopf gestellt
Problem: ein Vorher-Nachher. Lösung: Kopffüssler. Flatlining reloaded.
Was ist nur mit den Schweizer Werbeagenturen los? Einzige Erklärung: es läuft ein geheimer Wettbewerb, wer einem Auftraggeber die bescheuertste Werbekampagne aufs Auge drücken kann. Ohne dass er mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wird.
Lange Zeit unerreicht war diese Kampagne auf Platz eins:

Ein Wilhelm Tell mit kaputter Armbrust, auf einem Zeitungsstapel, hinter sich ein Radio, vor sich ein Laptop, in der Hand ein Handy. Ein nicht unwesentlicher Beitrag dazu, dass zum grossen Ingrimm der Verlegerclans die zusätzliche Steuermilliarde an der Urne abgelehnt wurde. Denn wenn man schon die Werbung nicht versteht, wieso soll man dann dafür sein, dass solch unfähigen Medienmanagern viel Geld reingestopft wird?
Die Werbeagenturen Farner und Rod hatten sich zusammengeschlossen, um diese einsame Höchstleistung im Tiefenrekord für unterirdische Werbung zu erbringen. Bravo.
Denn nur gemeinsam war es möglich, die alleine von Rod verantwortete Schwachsinns-Kampagne «So schützen wir uns» noch zu unterbieten.
Der Wettbewerb war lanciert, als Nächster griff Scholz & Friends in den Wettbewerb ein und besetzte die Pole Position. Denn wenn der Bund zahlt, ist nun wirklich alles erlaubt, gibt es nach unten keine Barrieren.

Verständlich, dass das Rod nicht auf sich sitzen lassen konnte. Schliesslich war man zweimal unangefochten auf Platz eins im Wettbewerb «wer macht die grottenschlechteste Werbung aller Zeiten» gelandet. Das zweite Mal allerdings nur mit Hilfe von Farner. Das schrie geradezu nach da capo.
Ausgerechnet das arme SOS Kinderdorf wurde zum nächsten Opfer von Rod. Hier geht es um ein klassisches, banales, schon ewig durchdekliniertes Problem in der Werbung: wie stelle ich ein Vorher-Nachher so dar, dass der Betrachter sofort kapiert, worum es geht? Da es ein uraltes Problem ist, gibt es ein Meer von guten Lösungen. Das geht aber auch anders, sagte sich Rod, man kann’s auch in den Sand setzen, bzw. auf den Kopf stellen.
Allerdings lag die Latte doch ziemlich hoch, bzw. tief. Also musste sich Rod echt anstrengen, um sowohl den Tell, die Covid-Kampagne wie auch die Füsse auf dem Radiator zu überbieten. Aber wenn sich der Werber richtig anstrengt, schafft er das:

Mal ganz langsam. Ja, das ist Maria Walliser, die Ex-Skifahrerin. Und ja, das ist eine Werbung für das SOS Kinderdorf:

Ist nun Walliser in diesem Kinderdorf aufgewachsen und deswegen ein «Ex-Kind»? Stand damals die Welt für sie auf dem Kopf? Oder für diese beiden hier:

Bevor jemand fragt: das sind Michèle und Manuel Burkart. Burkart who? ZACKBUM gesteht: wir wussten auch nicht, dass das unter «Moderatorin/Komiker» läuft. Haben die etwa auch ihre Jugend im SOS Kinderdorf verbracht? Vielleicht verstehen wir das besser, wenn wir das Sujet mal umdrehen:

Öhm. Oder spielt das niedliche Geisslein eine Rolle, die wir nicht durchschauen? Vielleicht ist’s so gemeint:

Verflixt, dann vielleicht im Querformat?

Hm, macht irgendwie visuell mehr Sinn. Oder ist’s Unsinn? Auf jeden Fall muss noch ein Rätsel aufgelöst werden. Nein, Walliser und das Duo «Komikerin/Moderator» (oder so) waren keine SOS-Kinder. Aber Kinder. Capito? Nein? Sacknochmal. Sie waren Kinder. Heute sind sie’s nicht mehr. Dafür setzten sie sich für Kinder ein, die immer noch Kinder sind. Kann doch nicht so schwer sein.
Dank persoenlich.com wissen wir auch, wer das verbrochen hat:

Das sind auch zwei Ex-Kinder, und der Struwwelpeter rechts sieht genauso aus, wie sich ein Möchtegern-Creative Director einen Creative Director vorstellt.
Was kann der zu seiner Verteidigung sagen?
«Obwohl der Zustand des Ex-Kindseins ja auf uns alle zutrifft, hat sich bisher noch niemand von uns als Ex-Kind bezeichnet. Wir haben die Chance ergriffen und glauben, dass wir so maximale Identifikation bei der Zielgruppe erreichen.»
Hä? Nein, das ist doch logisch. Wenn man die Werbekampagne nicht versteht, versteht man dieses Gequatsche auch nicht. Dabei liesse sich das alles einfach zusammenfassen. Die armen Kinder. Das arme SOS Kinderdorf. Mal wieder auf einen reingefallen, dessen Lebensmotto hinter der Sonnenbrille wohl ist: Kann nix. Macht nix.