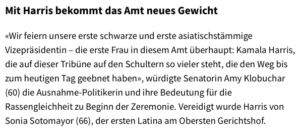Trotz alledem
Liegt es an der Konkurrenz? Die NZZ bleibt ein Leuchtturm.
ZACKBUM wühlt sich täglich durch den Morast. So kommen uns die Expeditionen in die Niederungen des Tagesjournalismus immer mehr vor. Kurze Denke, atemlose Schreibe. Niveaulos, kulturlos, kenntnislos. Ungebildet und holperig, Fast Food, wobei man nie weiss, wo der Hamburger oder die Pizza aufhört und der Karton anfängt. Geschmacklich ist das sowieso schwer zu unterscheiden.
Und dann scrollt man durch die Homepage der NZZ und muss zugeben: immerhin, da ist noch Nahrung vorhanden, keine Sättigungsbeilage, die hungrig lässt.
Gut, Kriegsgurgel Rásonyi startet nicht mit einem Highlight, sondern mit einem Ärgernis. Aber kein Blatt ist unfehlbar, und den Auslandchef könnte höchstens der Chefredaktor an die Kandare nehmen, und will er das. Wahrscheinlich profitiert der Irrwisch davon, dass Gujer durch die Nachfolgeregelung bei der NZZaS etwas abgelenkt ist.
Aber nach diesem Ärgernis herrscht Freude. «Letztlich heisst finanzielle Repression, Geld von alten Leuten zu stehlen». Ein Interview der klaren Worte mit Russell Napier. Ein Hintergrundbericht zur jüngsten Schiffskatastrophe im Mittelmeer. Eine grafische Aufbereitung der Verluste, die Russland im Ukrainekrieg erleidet. Selbst «Wie viel Wokeness verträgt die Vogue» ist der NZZ ein (guter) Artikel wert.
Lucien Scherrer, der im Roshani-Skandal eine eher trübe Rolle spielte, rehabilitiert sich mit einem Artikel nach dem anderen. Zuletzt ging er den Erzählungen von Sibylle Berg über ihre Biographie und über angeblich Erlebtes in Reportagen nach. Aktuell nimmt er sich George Soros vor, der jedes Jahr 1,5 Milliarden Dollar verteilt. «Dabei fördert er auch Feinde der offenen Gesellschaft.» Zu recht der meistgelesene Artikel.
Ein dystopischer Roman von C.F. Ramuz, der erst kürzlich auf Deutsch übersetzt wurde, ein hübsches Essay über den Pool, wo «Träume wahr werden –Alpträume aber auch».
Eine erfrischend nachdenkliche Analyse zum Wahlsieg der AfD in Deutschland, ein bissiger Artikel über eine weitere Sammelklage gegen die CS in New York. Selbst einen geschmäcklerischen Artikel darüber, wie «das Besteck in Szene gesetzt wird», verzeiht man der NZZ.
Damit haben wir nur eine Auswahl der aktuellen Artikel erwähnt. Was dabei auffällt: mit der negativen Ausnahme von Rásonyi spielt die Befindlichkeit, die unqualifizierte, aber persönliche Meinung keine grosse Rolle. Die Welt ist nicht so, wie sie zu sein hätte, aber obwohl ich es ihr sage, hört sie nicht auf mich: dieses weitverbreitete Leiden findet man in der NZZ glücklicherweise nur in homöopathischen Dosen.
Daher verzeiht man der NZZ gelegentlich Ausrutscher nach unten. Weil in der übrigen Presse die Aufschwünge nach oben noch viel, viel seltener sind.