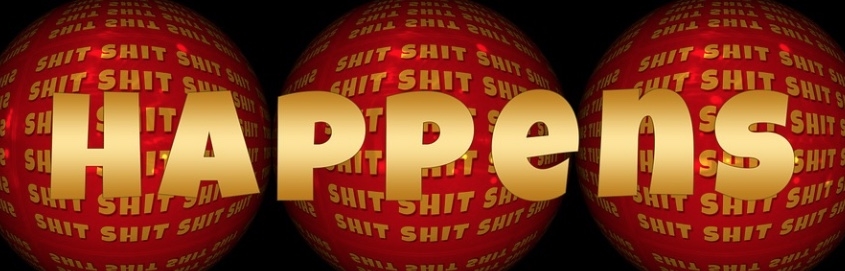So endet «Der Prozess» von Franz Kafka. So können die Medien enden.
Seit es das Internet und das Digitale gibt, ist der Satz «lügt wie gedruckt» leicht veraltet. Aber nur technologisch, nicht inhaltlich.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Seit dem Aufkommen der Presse, was auch noch nicht so lange her ist – weder Ägypter noch Griechen kannten das –, wogt die gleiche Debatte. Wer entscheidet wonach, was es wert ist, publiziert zu werden?

Ein Genie verfilmte Kafka mit einem genialen Anthony Perkins.
Wer entscheidet wonach, wie es kommentiert, gefärbt, beurteilt wird, moderndeutsch «geframt»? Haben sich die Medien das Schmähwort von der «Lügenpresse» redlich verdient oder ist das ein dümmlicher Kampfbegriff von Marginalisierten und Verpeilten?
Gedrucktes ist normalerweise schwarz auf weiss, seltener weiss auf schwarz. Die Wirklichkeit ist aber mindestens grau, häufig bunt, scheckig und kompliziert.
Wo fängt unzulässige Beeinflussung an, wo hört die redaktionelle Unabhängigkeit auf? Ist es eine Karikatur aus dem Bilderbuch des Antikapitalisten, dass der Besitzer der Produktionsmittel, hier des Verlags, befiehlt, wo’s langgeht? Oder geben die Schweizer Medienclans die grossen Linien vor? Lesen wir also im Wesentlichen, was Coninx-Supino, Ringier-Walder , Wanner-Wanner oder Lebrument-Lebrument genehm ist?
In Krisen und Kriegen stirbt die Wahrheit zuerst
Fangen wir mit den Basics an. Erinnert sich irgend jemand, in deren Hausorganen einen kritischen Bericht über diese Clans gelesen zu haben? Ist doch auch logisch, wenn mir «Tages-Anzeiger» oder «Blick» gehören würden, fände ich es auch nicht lustig, von meinem eigenen Blatt in die Pfanne gehauen zu werden.
In Krisenzeiten scharen sich Massenmedien gerne um die Regierenden. In den beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts wurde Unsägliches auf allen Seiten publiziert. Gelogen, gehämt, gekeift, gehetzt, ganze Weltbilder auf Lügen und Verzerrungen aufgebaut.

Vor dem Gerichtshof der Massenmedien.
Auch im Kalten Krieg gab es unschöne Auswüchse. Unvergessen die Hetze der NZZ gegen den Kommunisten und Kunsthistoriker Konrad Farner Mitte der Fünfzigerjahre. Unvergessen der Inserateboykott der Autolobby gegen den «Tages-Anzeiger». Unvergessen das Schreibverbot gegen Niklaus Meienberg, das damals Otto Coninx unverblümt als persönliche Abneigung verteidigte: «Daneben aber hat sich ein ungutes Gefühl bei mir verdichtet, ich verspürte einen Aberwillen gegen M.s Schreibart, seine Einseitigkeit, seine Verzerrungen, sein Verhältnis zur Schweiz, seine Animosität, seine Manipulation, der ich mich persönlich als Leser ausgesetzt sah.»
Beziehung Medien – Masse: es ist kompliziert
Einzelfälle, dagegen steht eine lange und strahlende Geschichte von durch die Medien aufgedeckten Skandalen? Muss man dann nicht auch die Glanztat eines Hansjörg Abt erwähnen, der hartnäckig den Hasardeur und Betrüger Werner K. Rey zur Strecke brachte? Auch hier könnte man eine lange Latte von Beispielen aufführen.
Aber sind das alles Gross- und Schandtaten aus der Vergangenheit, weil es an Beispielen aus der Gegenwart mangelt? Durchaus nicht. Das Internet ermöglicht ganz neue Formen der Recherche und Aufdeckung. Was früher mühsam in Archiven oder vor Ort zusammengesucht werden musste, ist heutzutage mit etwas Gelenkigkeit am Bildschirm möglich. Allerdings sind die ewigen «Leaks» und «Papers» kein Glanzlicht dieser neuen, schönen Welt. Sondern verantwortungslose Verwertung von Hehlerware, die von anonymen Quellen zugesteckt wird, ohne dass man deren Motive kennen würde.

Blick in einen Newsroom …
Zudem sind die Medien in einen fast perfekten Sturm geraten. Einbrechende Inserate im Print, im Web nehmen ihnen Internet-Giganten wie Google, Facebook oder Amazon die Butter vom Brot. Inhaltliches und im Umfang dramatisch Geschrumpftes wird hartnäckig zu den gleichen Preisen wie früher angeboten.
Die Personaldecke wird dünn und dünner; drei der vier überlebenden Tageszeitungskonzerne verdienen ihr Geld längst mit journalismusfremden Tätigkeiten. Um für wegfallende Einnahmen kompensiert zu werden, fahren sie zudem einen erkennbaren Schmusekurs gegenüber Staat und Regierung.
Grenzenlose Vermischung von Bezahltem und Berichtetem
Auch die Pandemie ist Anlass, staatstragende Geräusche von sich zu geben. Das ist nicht verboten, aber da es inzwischen faktisch Tageszeitungsmonopole gibt, wäre es schön gewesen, wenn die Behauptung, Forumszeitung und Plattform zu sein, mehr als ein Lippenbekenntnis wäre.
Die schon immer sehr dünne Grenzlinie zwischen bezahltem und selbst erstelltem Inhalt verblasst bis zur Unsichtbarkeit. Früher inhaltsschwere Worte wie «recherchiert», «investigativ», «undercover» oder «Reportage» denaturieren zu Lachnummern.
Das alles sind unangenehme Begleiterscheinungen. Aber die Wurzel des Übels liegt woanders: Glaubwürdigkeit behält man, wenn man nicht heuchelt. Vertrauen geniesst man, wenn man nicht lügt. Kompetenz und Nutzwert strahlt man aus, wenn man inhaltlich und intellektuell etwas zu bieten hat.
Den Anspruch, «wir liefern euch gegen Bezahlung eine professionell gemachte Auswahl der wichtigsten News des Tages, kompetent dargeboten, eingeordnet und analysiert», den kann man behaupten. Wenn man an ihm Tag für Tag scheitert, dann schafft man sich selbst ab.
Arbeiten an der Selbstabschaffung
Genau daran arbeiten die drei grossen Medienkonzerne der Schweiz. Der vierte versucht immerhin, auf Content, Journalismus und Inhalt zu setzen. Und die Staatsmedien, denn nichts anderes ist die SRG, können trotz garantierten Einnahmen immer weniger den Anspruch erfüllen, die Grundversorgung an Informationen aufrecht zu erhalten.

Wenn’s im «Prozess» dem Ende zugeht.
Nur ein Symbol dafür: Wer eine Wirtschaftssendung wie «Eco» ersatzlos streicht, setzt keine Sparmassnahme um, sondern holzt einen Grundpfeiler des Service publique ab.
Die schrumpfende Bedeutung der Medien, der zunehmende Verlust der Deutungshoheit in der öffentlichen Debatte, mangelnde Ressourcen und bescheidene intellektuelle Kapazitäten werden kompensiert mit verbitterter Rechthaberei, mit Kommentaren, die sich mit dem eigenen Bauchnabel, eingebildetem oder geklautem Leiden befassen. Die ungefragt und sowohl haftungs- wie verantwortungsfrei kreischig Ratschläge erteilen, Forderungen aufstellen, Handlungsanleitungen geben.
Einen guten Ruf erarbeitet man sich über lange Zeiten. Verspielen kann man ihn mit wenigen Handgriffen. Wir haben keine «Lügenpresse» in der Schweiz. Aber «All the News That’s Fit to Print» ist’s schon lange nicht mehr.