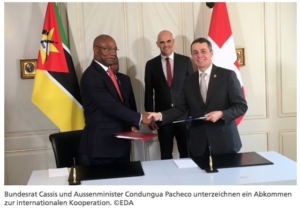Ist die Schweizerische Nationalbank ein Herrenclub, ladies and gentlemen?
Die Methode ist bekannt. Sexismus, Mobbing, Skandal. Hat die «Republik» schon mehrfach probiert, ist damit aber auch regelmässig auf die Schnauze gefallen.
Auch ihr Versuch, mit angeblich unbeaufsichtigten, schlecht ernährten und sonst wie gequälten Kindern beim grössten Schweizer Anbieter von Kitas zu punkten, war ein Griff ins Klo: alle offiziellen und externen Untersuchungen ergaben: nix dran, nix zu meckern.
Mal wieder Aufgewärmtes, frisch serviert
Nun probiert es die «Republik» mal mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Mit knapp 24’000 Anschlägen ist der Artikel für «Republik»-Verhältnisse geradezu schlank und rank. Er hat allerdings, wie schon der Versuch, mit dem aufgewärmten Bündner Bauskandal zu punkten, eine Vorgeschichte.
Denn ein gewisser Fabio Canetg publizierte am 2. September auf swissinfo.ch einen Beitrag über die SNB: «Es ist etwas faul bei der SNB. Es riecht nach Geschlechterdiskriminierung». Diese Aussage basiert auf einer Auswertung der Geschlechterverteilung in Führungspositionen. 117 von 145 seien von Männern besetzt, weiss Canetg. Also 81 Prozent, bei der US-Notenbank seien es lediglich 57 Prozent.
Klarer Fall, Diskriminierung. Und dabei spricht Canetg den Skandal gar nicht an, dass der Anteil von «divers» bei null liegt. Wobei, halt, der Skandal ist, dass Canetg dieser Skandal gar nicht auffällt. Wo die «Republik» doch selbst ihren launigen Gruss zu «Ladies, Gentlemen and everybody beyond» angepasst hat.
Warum nicht mal durchschütteln, mixen und neu einschenken?
Aber Scherz beiseite, wie es der Zufall so wollte, unterhält Canetg auch noch einen «Geldcast», und bei dem war Patrizia Laeri zu Gast. Genau, die Kürzestzeit-Chefredaktorin von CNN Money, zurzeit offen für Neues. Sie selbst kann sich über Frauendiskriminierung nicht wirklich beschweren, aber laut Canetg hätten sich dann ein rundes Dutzend Frauen bei ihr und ihm gemeldet, die von haarsträubenden Zuständen bei der SNB zu berichten wussten.
Da dachten sich Laeri und Canetg: he, wieso schütteln wir den Ursprungsartikel nicht mal gut durch, stecken ihn in den Mixer mit Auszügen aus anonymen Erfahrungsberichten, und fertig ist der Smoothie, der den «Republik»-Lesern runter geht wie ein Latte Macchiato, gebraut mit Kaffeebohnen aus Nicaragua.
«Steinzeitlich» und «autoritär» gehe es bei der SNB zu, weiss die «Republik», Thomas Jordan trage den Übernamen «Mr. Konservativ» und herrsche mit nahezu unbeschränkter Macht, zudem würden Leute mit «einer bestimmten politischen Richtung» gezielt befördert. Ich finde es ja auch bedauerlich, dass unser oberster Währungshüter nicht gelegentlich Salsa tanzt und nach sechs Mojitos nach Hause geschleift werden muss. Aber mit Sexismus hätte das noch nicht viel zu tun.
Eher ein leiser als ein lauter Sexismus
Das fällt gerade rechtzeitig auch den «Republik»-Autoren ein, also fahren sie fort, durch alles hindurch ziehe sich «ein manchmal leiser, öfter offenkundiger Sexismus. Der sich auch daran zeigt, dass bei der Nationalbank auf 8 von 10 Führungsposten Männer sitzen.»
Das kann Sexismus sein, das könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass selbst aktuell nur 35 Prozent aller Studenten der HSG weiblich sind. Aber wie auch immer, es gibt genügend geschilderte Vorfälle, um anzunehmen, dass die SNB ein paar Probleme mit Frauen hat. Beziehungsweise mit deren Behandlung und Förderung.
Wer nun aber saftige Darstellungen übler Übergriffe erwartet, wird enttäuscht. Um «Skandal, Sexismus, Chauvinismus» und «strukturell verankert» zu krähen, das geben die Fallbeispiele eigentlich nicht her.
Fragen bei Bewerbungsgesprächen, die fehl am Platz sind, so zu früherem Einkommen oder der familiären Situation, die aber selbst von einem «Republik»-Experten allerhöchstens als «grenzwertig» bezeichnet werden, das ist zwar nicht gut, aber weit von einem Skandal entfernt.
Dann gibt es Klagen über «ganz normalen Alltagssexismus». Der äussere sich darin, dass Frauen unter Druck gesetzt würden, ein Vorgesetzter habe einmal einer Mitarbeiterin erklärt, wofür deren Geschlechtsorgane gut seien.
Die allgemein übliche Lohndiskriminierung
Schliesslich die in der gesamten Schweizer Arbeitswelt vorhandene Lohndiskriminierung. Das ist nun wirklich kein spezifisches Problem der SNB. «Die hier geschilderten Vorfälle wiegen schwer», urteilt die «Republik» in eigener Sache. Publizitätshungrige Politiker eilen natürlich herbei und kündigen gewichtig parlamentarische Vorstösse an.
Ohne einen einzigen der geschilderten Vorfälle verniedlichen oder bezweifeln zu wollen: Die SNB hat 937 Mitarbeiter. Dass es unter denen den einen oder anderen testosterongesteuerten Macho gibt, ist bedauerlich. Lohndiskriminierung per Geschlecht ist nicht nur bei der SNB ein Problem. Aber angesichts der geringen Zahl und der geringen Schwere der geschilderten Vorfälle hat SNB-Direktor Thomas Jordan natürlich recht, wenn er von inakzeptablen Einzelfällen spricht.
Dass sich weder er noch die SNB zu spezifischen, einzelnen Fällen äussern, ist keine Dialogverweigerung, sondern schlichtweg als Arbeitgeberpflicht vorgeschrieben.
Zwei Fragen drängen sich allerdings auf
Zwei Fragen stellen sich aber doch bei diesem Artikel: Fabio Canetg bezeichnet sich darin selbst als «Geldökonom». Da täte vielleicht eine Fortbildung not, denn mit seiner Behauptung, die SNB verwalte «ein Volksvermögen von 950 Milliarden Franken», würde er bei jedem Anfängerkurs an der HSG durchfallen.
Und müsste eigentlich von der Uni verwiesen werden, da er selbst auf Nachfrage sich nur artig für das Interesse bedankt und auf die Webseite der SNB verweist, wo als «Anlagevolumen» per Ende Juli 949 Milliarden Franken aufgeführt sei. Meiner Treu, wenn das die wissenschaftliche Zukunft der Schweizer Volkswirtschaft ist. Setzen, Strafaufgabe: Wir basteln uns eine doppelte Buchhaltung, schreiben links Aktiva und rechts Passiva und schauen, was rechts übrig bleibt, wenn man die Passiva von den Aktiva abzieht. Waseliwas?
Schliesslich ist dieser «Republik»-Artikel die Fortsetzung eines Werks für swissinfo. Sich selbst kopieren ist durchaus erlaubt, wenn auch nicht rasend originell. Aber im Kampf gegen Frauendiskriminierung muss die Frage erlaubt sein, wieso in der «Republik» die Mitarbeiterin, mit deren «Unterstützung» Canetg das Original schrieb, unerwähnt bleibt. Die Nachfrage nach der verschwundenen Mitarbeiterin am Artikel beantwortet Canetg einfach nicht. Auch auf die Gefahr hin, sich damit doch einem verschärften Sexismusverdacht auszusetzen. Stolz vermerkt Canetg im «Republik»-Artikel hingegen, dass ebenfalls der «Blick» über dieses Männerproblem bei der SNB berichtet habe.
Darf man das Inzucht nennen, oder wäre das irgendwie -istisch?
Wäre es wirklich ein Platzproblem geworden, wenn er erwähnt hätte, dass die «Blick»-Kolumnistin Patrizia Laeri, seine Mitautorin, in ihrer «Blick»-Kolumne seinen swissinfo-Artikel lobend erwähnte? Eingeleitet mit der vorwurfsvollen Schilderung, dass sich Thomas Jordan doch erfrecht habe, auf eine Reihe blöder Fragen von ihr bei einer Pressekonferenz höflich zu antworten: «Frau Laeri, diese Fragen meinten Sie aber nicht ernst?»
Wenn Jordan wüsste, wie knapp er da einem Sexismus-Vorwurf entkam, wo Laeri doch einen grünen Rock trug und sich nach der Nachhaltigkeit von SNB-Anlagen erkundigte.
Wie viele Mitarbeiter braucht es, um Externe Artikel schreiben zu lassen?
Sozusagen in eigener Sache noch zwei Bemerkungen zur «Republik». Trotz 50 Nasen auf der Payroll wurde dieser Artikel, mit dem das Online-Magazin mal wieder in die Schlagzeilen kommen will, von zwei Externen geschrieben. Genauso wie die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals und seine Enthüllung in der «Financial Times» der Einfachheit halber von der FT übernommen wurde.
Wenn man alles zusammenzählt, hat die «Republik» in den vergangenen sieben Tagen 29 Stücke rausgepustet. Davon höchstens 27 eigene. Also nur unwesentlich mehr als ZACKBUM.ch. Was dort pro Monat so eine halbe Million kostet, hier bei drei Nasen null.
Wollen sich die Genossenschafter der «Republik» so nebenbei entmannen lassen?
Und so ganz nebenbei gibt die «Republik» bekannt, dass es mal Zeit für eine Statutenänderung sei. Nix wirklich Wichtiges, einfach eine Anpassung, Präzisierungen, you know, ladies and gentlemen. Darin versteckt wird die Budgethoheit von der Genossenschafterversammlung auf den Vorstand verschoben. Dessen Mitglieder auch nicht mehr jedes Jahr, sondern nur noch alle drei Jahre gewählt werden sollen.
So genossenschaftlich-republikanisch und basisdemokratisch soll es also bei der «Republik» künftig zu und hergehen. Erinnert irgendwie an die «Animal Farm» von Orwell, finde ich.
Man darf gespannt sein, ob die dafür nötige Zweidrittelmehrheit bei der Urabstimmung erzielt wird; sich die Genossenschafter also selber, Pardon, entmannen wollen. Wo doch die Finanzen nicht so wirklich die Kernkompetenz der «Republik»-Macher sind.