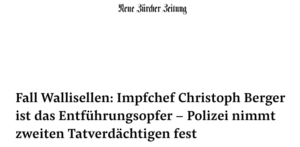Klag dir eins
Die juristische Keule gegen den Journalismus.
Gerade haben wir den eigentlich witzigen Fall, dass eine Bank sich durch Artikel und Kommentare auf «Inside Paradeplatz» in ihrer Persönlichkeit verletzt sieht. Das sei in 29 Artikeln und in 287 Kommentaren erfolgt, behauptet die Zivilklage. Ihr ging eine Strafanzeige in der gleichen Sache voraus.
Alleine die Zivilklage umfasst 265 Seiten. Da in einem Zivilprozess jeder einzelne Klagepunkt kommentiert und widerlegt werden muss, sonst gilt er als eingestanden, bedeutet das entsprechenden Aufwand für IP. Und genau das dürfte die Absicht der Bank gewesen sein. Schutz der Mitarbeiter oder die Forderung nach Gerechtigkeit wirken hingegen lächerlich und als vorgeschobene Gründe, um einen unliebsamen Kritiker finanziell fertig zu machen.
Witzig an diesem Fall ist, dass die kritisierte Bank inzwischen faktisch aufgehört hat zu existieren, denn es handelt sich um die Credit Suisse. Damit stellt sich die Frage, ob auch die UBS nichts Besseres zu tun hat, als diese Klage weiterzuverfolgen. Vielleicht wäre es mit der CS nicht so weit gekommen, wenn sie sich statt um solchen Pipifax um wirklich wichtige Dinge gekümmert hätte.
Auf jeden Fall ist hier Licht am Ende des Tunnels für Lukas Hässig, der zugegebenermassen einen scharfen Reifen in seinen Artikeln fährt. Und in den Kommentaren vielen gefrusteten Bankern Gelegenheit gibt, unter Pseudonym abzulästern – statt was Sinnvolles für ihre Bank zu tun.
Aber während diese Klage möglicherweise mitsamt der CS beerdigt wird, ist die Drohung mit der juristischen Keule inzwischen ein probates Mittel geworden, um kritische Berichterstattung zu erschweren – oder gar zu verunmöglichen. Dazu trägt auch bei, dass die Schwelle für das Erlangen einer superprovisorischen Verfügung dank geschickter Lobbyarbeit im Parlament gegen den erbitterten Widerstand vieler Juristen gesenkt wurde.
Superprovisorisch – als Fremdkörper in der Rechtssprechung – bedeutet, dass auf Antrag ein Gericht eine Massnahme beschliessen kann, ohne dass die betroffene Seite vorab Gelegenheit bekäme, sich dagegen zu wehren. Natürlich kann das dann in einem ordentlichen Verfahren nachgeholt werden. Aber in der journalistischen Praxis hat das ganz üble Auswirkungen.
Denn im seriösen Journalismus, also ausserhalb der «Republik», ist es normal und üblich, dass nach der Recherche der oder die Betroffenen Gelegenheit bekommen, sich dazu zu äussern. Man konfrontiert sie also mit den wichtigsten Vorwürfen. Das kann zu verschiedenen Reaktionen führen. Zu einem trockenen «kein Kommentar, und das ist kein Zitat» über längliche Gegenreden bis zum Gang ans Gericht mit der Forderung, die Publikation des geplanten Artikels zu verbieten, weil seine Veröffentlichung nicht wiedergutzumachenden Schaden anrichten würde.
Natürlich ist es widerlich, wenn wie im Fall eines Schweizer-angolanischen Geschäftsmanns ein im roten Bereich drehender Tamedia-Journalist aus gestohlenen Geschäftsunterlagen wilde Anschuldigungen herausmelkt, darauf die Mühlen der Justiz in Gang kommen – und am Schluss der Geschäftsmann von allen Vorwürfen auf ganzer Linie und überall entlastet, freigesprochen wird. Aber er selbst und seine Firmen sind danach kaputt.
Solcher Borderline-Journalismus schadet natürlich dem Metier und bringt es zusätzlich in Verruf. Glücklicherweise sind Christian Brönnimanns nicht allzu häufig unterwegs. Aber auch nach der Publikation eines Artikels wirkt das Erheben der juristischen Keule manchmal Wunder.
Auch dem Autor dieser Zeilen ist es schon mehrfach passiert, dass Artikel – ohne sein Einverständnis oder seine Kenntnis – urplötzlich online verschwanden. Auf Nachfrage wurde jeweils erklärt, dass der im Artikel Kritisierte seinen Rechtsanwalt den üblichen Textbaustein absondern liess. Man zeige die Vertretung von an, müsse diese und jene Textstelle bemängeln, verlange Löschung oder Korrektur plus Entschuldigung, sonst kracht’s.
Das letzte Mal scheint das in Deutschland funktioniert zu haben, als dort ein kritisches Buch über die hasserfüllte Kämpferin gegen Hass im Internet erscheinen sollte. Die Intervention eines teuren und entsprechend beleumdeten Anwalts genügte, dass der Verlag einknickte und das Buch nicht auslieferte. Als die Autorin das dann im Eigenverlag in der Schweiz tat, passierte – nichts. Ein Beispiel, wie man mit leeren Drohungen Wirkung erzielen kann.
Auch grosse Verlage wie CH Media oder Tamedia scheuen rechtliche Verwicklungen wie der Teufel das Weihwasser. Eine Superprovisorische verschiebt zumindest die Veröffentlichung eines Artikels, ihre Bekämpfung kostet. Selbst wenn sie weggeräumt wurde, kann es sein, dass der Artikel inzwischen seine Aktualität eingebüsst hat. Viel Geld für nix.
Auch bei nachträglichen Beanstandungen gibt es immer das Prozessrisiko, dass der beklagte Verlag verlieren könnte. Und selbst wenn er gewönne, die Gegenseite zahlt nie den tatsächlich angefallenen Aufwand des eigenen Anwalts.
Früher, in den besseren Zeiten, war es noch eher eine Prinzipiensache, dass sich Medien nicht so einfach einschüchtern liessen. Heutzutage ist die Abklärung des möglichen Prozessrisikos ein fester Bestandteil der Prozeduren bei der Veröffentlichung eines Artikels.
Damit kann die sogenannte Vierte Gewalt immer weniger ihren Kontrollaufgaben nachgehen. Denn es ist schon so, wie es in einem George Orwell zugeschriebenen Zitat heisst: «Journalismus bedeutet, etwas zu drucken, von dem irgend einer will, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist PR.»