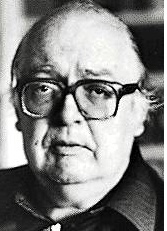Du nix verstan?
Kann man Feminist und Rassist sein? Aleksandra Hiltmann weiss Rat.
Es gibt anscheinend einen Sturm im Wasserglas. Denn die deutsche Autorin Sophie Passmann hat in einem Interview etwas gesagt. Wer in die Sektensprache des modernen Feminismus nicht eingeweiht ist, hat vielleicht etwas Mühe, den Satz zu verstehen: «Wenn Redaktionen im Namen des Antirassismus eine schwarze Frau zum vermeintlichen Sprachrohr von rassistischen Erfahrungen in Deutschland machen, führt das dazu, dass wieder nur ein Standard reproduziert wird: Wer spricht am lautesten, am funkiesten in ein Interviewmikrofon hinein?»
Item, das sei rassistisch, ein Shitstorm brandete über die Autorin, die sich beleidigt aus der Erregungsmaschine Twitter zurückzog. Hat niemand so richtig verstanden, aber nun will Tamedia-Autorin Aleksandra Hiltmann einordnen. Und ZACKBUM darf eine Fortsetzung zum Thema «Tagi-Leser sind Masochisten und zahlen dafür, dass sie gequält werden» schreiben.
Denn die Mit-Rädelsführerin der unbelegten Verleumdungen von 78 Tamedia-Frauen äussert nun Unverständliches über Unverständliches. Den diesen Shitstorm auslösenden Satz mag sie gar nicht zitieren, sie setzt offenbar voraus, dass der jedem Tagi-Leser geläufig ist:

Soweit ZACKBUM Hiltmann verstanden hat, findet sie es wichtig und richtig, dass Passmann für diese Aussage, die eigentlich keiner versteht, kritisiert wird. Denn: «Unkonstruktive Kommentare bedeuten nicht, dass sämtliche Kommentare zu einem Thema unangebracht oder nichts wert sind.» Das mag wahr sein, nur: na und?
Bisher können selbst alte, weisse Männer vielleicht noch folgen. Ab hier wird’s dann schwierig: «Es geht darum, wie oft und wo People of Color, Women of Color, im Feminismus, in den Medien und in der Öffentlichkeit repräsentiert sind – oder eben nicht.» Hier wird’s dann unmöglich: «Es geht um Intersektionalität, also darum, dass es Menschen gibt, die verschiedenen Unterdrückungsmechanismen gleichzeitig ausgesetzt sind.»
Nun wird’s zur unverhohlenen und offenen Quälerei des Lesers (doch, da müsst Ihr durch; hier ist’s wenigstens gratis):
«Es geht also auch um weisse Privilegien, ebenso um weissen Feminismus. Also «einen Feminismus, der die Interessen weisser Frauen ins Zentrum stellt» und der «einer Gruppe zugutekommen soll, die in vielerlei Hinsicht privilegiert ist», das heisst oft auch Frauen, die keine Behinderungen haben und über genügend finanzielle Ressourcen verfügen, formulierte es die Autorin, Afrikawissenschaftlerin und Lehrbeauftragte Josephine Apraku neulich beim deutschen Radiosender Cosmo. Privilegiert aber vor allem auch deswegen, weil weisse Frauen zwar benachteiligt werden von patriarchalen Strukturen, nicht aber von rassistischen. Women of Color hingegen sowohl als auch.»
Weisse Frauen leiden unter dem Patriarchat, sind aber privilegiert und haben keine Behinderungen. Andersfarbige Frauen werden doppelt benachteiligt, behauptet Hiltmann. Das nennt man Schwarzweissdenken.
Aber im Ernst: wie kann es ein Publikumsmedium zulassen, das von seinen Konsumenten Geld einfordert, dass ein solches Sektengeschwätz ungefiltert Hunderttausenden Lesern serviert wird? Wo bleibt da die vielgerühmte Qualitätskontrolle? Traut sich denn kein zurechnungsfähiger Blattmacher (m,w,d) mehr, solche Hirnrissigkeiten abzulehnen? Oder soll das ein Belastungstest sein, wie stark man das Publikum quälen kann, bis es schreiend das Weite sucht?
Wohin dieser Sektenwahnsinn führt, zeigt gerade ein absurdes Theater, dass der «Tages-Anzeiger» doch tatsächlich zur Frontmeldung macht:

Das Stürmchen im Wasserglas: In einer Alternativbeiz zu Bern genossen Alternative ein Alternativkonzert. Bis das in der Pause abgebrochen wurde. Ein Musiker unpässlich geworden? Stromrechnung nicht bezahlt? Kä Luscht? Nein, schlimmer. Ein paar Gäste hätten sich beschwert, dass es ihnen «unwohl» geworden sei. Zu viel geschluckt? Falsches geraucht? Nein, schlimmer. Ihnen sei unwohl, weil ihnen die «kulturelle Aneignung» einiger Mitglieder der Band übel aufgestossen sei. Die seien nämlich weiss, aber trügen Dreadlocks und spielten Reggae. Nun dürfen diese Stinklocken offenbar nur nicht-weisse Jamaikaner tragen. Oder so. Auf jeden Fall entschuldigten sich die Veranstalter und beklagen «Sensibilisierungslücken».
Nein; ZACKBUM hat keine verbotenen Substanzen inhaliert, so etwas kann man nicht halluzinieren oder erfinden. Aber damit ist der Wahnsinn ja noch nicht zu Ende. Nach Hiltmann serviert das Qualitätsmedium Tagi diesen Stuss seinen Lesern auf Seite eins. Denn diese Debatte habe nun auch die Schweiz erreicht. Nein, diese Debatte findet nur innerhalb kleinster Sektenzirkel von verpeilten Fanatikern statt.
Und wenn dem Tagi im Sommerloch wirklich keine Story mehr einfällt, hätten wir zumindest einen Alternativtitel für die Front zu bieten: «Käufer, verpisst euch und lest was Anständiges». Das wäre wenigstens ehrlich.