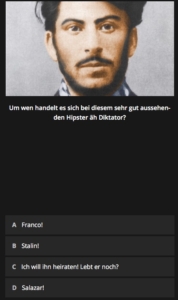Ach du blödes Ei
Sandro Benini setzt den Tagi-Niedergang fort. Wenn auch auf höherem Niveau.
Vielleicht liegt es an den Kommentaren von Raphaela Birrer, Angela Barandun, Philipp Loser oder Andreas Tobler, dass dem Tagi die Leser in Scharen davonlaufen.
Vielleicht liegt es auch an einer verbohrten Grundhaltung, die Sandro Benini auf einem intellektuell und sprachlich durchaus höheren Niveau zum Ausdruck bringt. In seinem Essay rührt er einiges zu einem unbekömmlichen Brei zusammen.
Er beginnt damit, dass sich die Grenzen zwischen linkem staatlichem Interventionismus und rechter staatlicher Zurückhaltung aufgelöst hätten. Als Beweis führt er diverse Wahlkampfversprechen an, obwohl er wissen müsste, dass hier alle Politiker von links bis rechts so ziemlich alles versprechen.
Allgemeines Geschwurbel widerlegt man am besten konkret. Angesichts der CS-Katastrophe fordert die SVP, dass alle «too big to fail»-Banken in der Schweiz zerschlagen werden sollten, damit genau keine Staatsintervention mehr nötig würde. Lustigerweise wurde diese Motion von den Grünen und zunächst auch von der SP unterstützt, die dann aber auf dem Absatz kehrt machte und sie versenkte. Ist alles ein wenig komplizierter, als Benini es sich zurecht schnitzt.
Aber dieser Fehlstart ist nur die Einleitung zum Hauptthema, der angebliche «Woke-Warnartikel». Unter diesem Oberbegriff subsumiert Benini dann alle Schlagworte von Cancel-Culture, politische Korrektheit, Meinungsdiktatur, Gesinnungspolizei, Tugendterror und vor allem entrüstet er sich darüber, dass von «selbst ernannten» Moralwächtern die Rede sei.
Dabei übersieht er geflissentlich, welche gefährlichen Ausmasse genau diese Haltung, beispielsweise an US-Universitäten, bereits angenommen hat. Die Beispiele sind Legion, wozu sie hier aufzählen. Bücher sollen umgeschrieben werden, Professoren müssen für Äusserungen wie «hallo, China man» um ihre Stelle fürchten, Auftritte an Universitäten müssen wegen Tugendterror abgesagt werden, Rastalockenträger und viele andere werden beschimpft, dass sie damit «kulturelle Aneignung» betreiben würden.
Es gäbe keine nennenswerte Cancel-Culture? Das sollte Benini mal dem Pink-Floyd-Gründer Roger Waters erzählen, dessen Auftritt in Frankfurt gerade gecancelt wurde. Neben anderen. Weil der Mann Meinungen hat, die dem, Achtung, Fake News, Mainstream nicht passen.
Von dem auch bei Tamedia seitenweise betriebenen Sprachwahnsinn, dem Gendersternchen, der inkludierenden Sprache, der Vergewaltigung der deutschen Orthographie und Syntax ganz zu schweigen. Vielleicht sollte sich Benini mal kundig machen, welchen Unsinn sein Kollege Andreas Tobler dazu schon publiziert hat – bei Tamedia. Auch Benini widerlegt sich selbst in seinem Pamphlet, weil er seine woken Reflexe nicht im Griff hat:
«Es stimmt, dass Wörter, die vor kurzem noch selbstverständlich waren (wie das N-Wort), heute tabu sind – zu recht.» Was meint er damit? Nigger, Neger, Nazi? Wieso kann er das Wort nicht ausschreiben? Ist es plötzlich toxisch geworden, vergiftet es den Leser?
Mit diesem Unsinn ist er nicht alleine. Konkretes Beispiel: in einer angeblich wissenschaftlichen Studie über die Verwendung des historisch unbelasteten Wortes «Mohr» schreiben die «Wissenschaftler» doch tatsächlich «M***», also sie verwenden den zentralen Begriff ihre Untersuchung gar nicht. Grotesk. Kein Wort der Sprache kann «tabu» sein.
Der Kampf um die Verwendung des Wortes Mohr als Hausbezeichnung wird in Beninis Tagi so dümmlich wie den geschichtsvergessenen Sprachreinigern zustimmend begleitet und kommentiert, nebenbei.
Was all diesen Sprachreinigern nicht auffällt: erstens ist die Sprache nicht die Wirklichkeit, sondern unser Mittel, sie zu beschreiben. Zweitens ist Sprachreinigung etwas zutiefst Diktatorisch-Faschistisches. Orwellsche Diktaturen wollen Begriffe verbieten, nationalsozialistische Sprachreiniger wollten das arische Deutsch von der Verschmutzung durch jüdisches Untermenschentum befreien.
Wer heute noch von «Tabu»-Wörtern spricht und das sogar begrüsst, steht knietief in diesem braunen Sumpf postfaschistischer Sprachreinigungsversuche. Sie gäbe es nicht? Sie gibt es innerhalb und ausserhalb von Tamedia. Vielleicht mal den Leitfaden, das Sprachreglement der ZHAW durchlesen. Vielleicht mal die diktatorischen Anwandlungen vieler Inhaber von völlig überflüssigen Gender-Lehrstühlen zur Kenntnis nehmen.
Wieso fällt einem bei diesen Zensurversuchen immer der Islam ein, der jede Abbildung Allahs und seines Propheten bei Todesstrafe verbietet? Genau wie deren angebliche Beleidigung durch kritische Worte. Vielleicht sollte Benini mal Salman Rushdie fragen ob Cancel-Culture existiert oder nicht. Ach, das sei dann bloss im fundamentalistischen Islam der Fall? Abgesehen davon, dass der seinen Anschlag im freisten Westen verübte: kennt Benini wirklich keine Dichterlesungen in Deutschland oder der Schweiz, die unter Polizeischutz stattfinden? Vielleicht sollte er auch mal mit Andreas Thiel sprechen.
Vielleicht will Benini aber einfach auch nicht aus seiner Gesinnungsblase (Achtung, auch so ein verdorbenes Wort) in die frische Luft heraustreten. Bloss reine Idiotie hingegen ist die Verwendung von Formulierungen wie «Publizisten und Politikerinnen». Der Versuch der Vermeidung des generischen Maskulins führt zu einem grammatikalischen Blödsinn.
All diese Anstrengungen, Indianerspiele, Winnetou, angeblich «verletzende» Textstellen zu «reinigen», widerspiegeln einen voraufklärerischen Sprachwahn, führen direkt zurück ins Mittelalter der kirchlich vorgeschriebenen richtigen Auslegung des angeblich geoffenbarten Wortes. Absurd, dass am Anfang des zweiten Jahrtausends noch solche Rückfälle stattfinden und verteidigt werden.
Nachdem sich Benini mit vielen Beispielen, aber doch kleinem intellektuellem Besteck an diesen Kritiken der Wokeness abgearbeitet hat, kommt er zum Schluss ziemlich abrupt zu seinem eigentlich Anliegen:
«Was die offene demokratische Gesellschaft tatsächlich bedroht, sind nicht die Woken, sondern Rechtspopulisten in Regierungsgebäuden, wie Orban oder noch vor kurzem Trump und Bolsonaro. Indem ein Teil derjenigen, die am lautesten über den Woke-Wahn ablästern, solch autoritäre Figuren verteidigen oder verharmlosen, steuern sie eine realsatirische Fussnote zum Kapitel «Verlogenheit» bei.»
Lustig, dass Benini sich über Politiker erregt, die allesamt in demokratischen Abstimmungen in ihr Amt kamen. Ob man deren Wirken kritisiert oder verteidigt, hängt schlichtweg von der politischen Position des Autors ab. Was daran eine «Fussnote zum Kapitel «Verlogenheit»» sein soll?
Verlogen sind all die Moralwächter, deren Verhalten ganz einfach dargestellt werden kann. Wenn jemand ein Argument formuliert, ob bescheuert oder bedenkenswert, gehen sie niemals auf das Sachargument ein. Sondern behaupten immer, dass dahinter eine bestimmte, verächtliche Haltung stünde. Genau diese Verwechslung macht Benini auch.
Um die Ärmlichkeit seiner Argumentation zu camouflieren, zitiert er zwar fleissig Werke und Autoren. In keinem einzigen Falle geht er aber über die Unterstellung gewisser Haltungen oder Ideologien oder Positionen hinaus und ins Konkrete. A sagt B, das ist falsch weil C. Das wäre ein Essay, das den Namen verdient.
Stattdessen schwurbelt Benini pseudogelehrt mit Beispielen aus den vergangenen Jahren, um seine Grundthese zu belegen, dass die Kritik an Wokeness bescheuert sei, weil es sie gar nicht gäbe.
Dieser Ansatz krankt an zwei Fehlern: natürlich äussert sich Wokeness bis zur Absurdität. Natürlich gibt es vor allem innerhalb von Tamedia einen klaren Kanon von erlaubten und verbotenen Meinungen. Natürlich sind auch hier Sprachreiniger und Sprachdikatoren unterwegs, hier werden von selbst ernannten (!) Sprachwächtern gute Wörter von Pfui-Begriffen unterschieden. Wer Pfuibäh verwendet, ist zudem ein Populist, ein Rechtskonservativer, gerne auch ein Hetzer, auf jeden Fall verlogen.
Sollte Benini wirklich noch Zweifel daran haben, dass es bei Tamedia so zu und hergeht, sollte er sich doch, statt irgendwelche Werke zu zitieren, in die Berichtserstattung über die Pandemie und vor allem über Kritiker an staatlichen Massnahmen vertiefen. Da sollte er sich mal die antidemokratische Haltung seines Politchefs anschauen, der doch tatsächlich forderte, dass endlich zwangsgeimpft werden sollte – ohne jegliche gesetzliche Grundlage.
Das alles wären Themen und Beispiele, denen man durchaus ein Essay widmen könnte. Aber dafür bräuchte es natürlich eine Zivilcourage, die heutzutage kein angestellter Redaktor mehr aufbringt.
Daher gilt auch hier, angesichts eines biblischen Feiertags:
«Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen! – und siehe, in deinem Auge steckt ein Balken! Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen!»
Oder noch einfacher: wer im Glashaus sitzt, sollte wirklich nicht mit Steinen werfen …