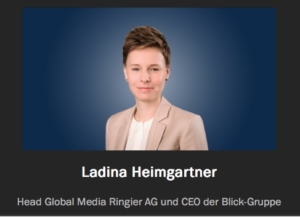Walder weg?
Journalisten in Hochform: Klatsch über sich selbst.
Neben dem eigenen Bauchnabel gibt es noch ein Objekt, das dem Journalisten ungemein wichtig ist: der Bauchnabel anderer Journalisten. Besonders, wenn sie eine bedeutende Position haben und nicht aus dem eigenen Haus sind.
Niemals würde es einem NZZ-Journalisten einfallen, ein kritisches Wort über den NZZ-Godfather Eric Gujer zu sagen. Der macht sich mit einem Wellness-Hotelaufenthalt samt Gattin lächerlich? Gerne liest man das auf ZACKBUM, aber nicht mal hinter vorgehaltener Hand wird darüber gekichert.
Niemals würde es einem CH Media-Journalisten einfallen, etwas Kritisches über das erratische Verhalten von Big Boss Wanner zu sagen. Wenn der sich als Kriegsgurgel outet oder einen fähigen Manager wegschiebt, damit ein weniger fähiger Sprössling nachrücken kann – kein Wort darüber.
Niemals würde es einem Tamedia-Journalisten einfallen, etwas Kritisches über den profitgierigen und nicht sonderlich erfolgreichen Big Boss Pietro Supino mitsamt seiner Protzvilla zu schreiben. Wie man es als Verlegerverbandspräsident mit der versammelten Medienmacht schafft, von einer kleinen Truppe die Subventionsmilliarde an der Urne weggenommen zu kriegen, sagenhaft.
Niemals würde es einem Ringier-Journalisten einfallen, etwas Kritisches über Michael Ringier, Frank A. Meyer oder Marc Walder zu schreiben. Der Big Boss hässelt gegen den kleinen Finanzblog «Inside Paradeplatz», FAM blubbert Kriegerisches über seinem Embonpoint, Walder erklärt ungeniert in der Öffentlichkeit, wie er seinen Redaktionen Leitlinien vorgibt: Schweigen an der Dufourstrasse.
Aber jetzt ist das Halali auf Walder eröffnet. Standleitung nach Bern, Hofberichterstattung gegen Primeurs, Männerfreundschaft mit Berset, Geben und Nehmen, überhaupt Walders Wunsch, als Emporkömmling mit Mächtigen und Wichtigen auf Augenhöhe zu scheinen. Gerd Schröder, eine Mission Putin, Bundesräte, Wirtschaftsführer, Bankenlenker, insbesondere der schöne Ermotti und der leutselige Vincenz, das ist Walders Welt.
Dazu die Digitalisierung. Weg mit den schlecht sitzenden Krawatten, stattdessen Rollkragenpullover und Sneakers, der Schweizer Steve Jobs kommt. Die Digitalisierung des Ringier-Konzerns dürfte ihm auch den Kopf retten in der aktuellen Krise.
Tamedia ist wie meist unentschieden, ob man der Konkurrenz Ringier eins reinwürgen will oder sich selbst. Für «sich selbst» ist der Politchef von Burg, für Ringier der Oberchefredaktor Rutishauser. Die NZZ hielt sich länger vornehm zurück, jetzt aber volles Rohr. Gleich drei Journalisten blättern alle Facetten der Story auf, mit dem provokanten Titel «Ringier-Chef Walder soll offenbar entmachtet werden». Lucien Scherrer versucht sich an einem Psychogramm: «Sein Problem: Er will von den Mächtigen geliebt werden.»
Federführend ist aber ein neues Dream-Team von CH Media. Oberchefredaktor Patrik Müller und der von der NZZ übergelaufene Francesco Benini treiben Walder und Ringier regelrecht vor sich her. Jedes Wochenende eine neue Enthüllung. Offenbar, denn natürlich wurden sie angefüttert, hat sich die Quelle überlegt, dass die «Weltwoche» nicht genügend Wirkung entfalten könnte. Zu klar positioniert, Mörgeli zu parteiisch. Also das auflagenstärkste Blatt, die «Schweiz am Wochenende».
Die spielt ihre Karten fantastisch aus. Es ist fast wie beim Schiffeversenken. Ansatzlos der erste Treffer, souverän Dementis und Gequengel abgewartet, dann letztes Wochenende der zweite Treffer. Und nun schon der dritte, fast könnte man sagen: «versenkt».
Neuste Schlagzeile: «Beben im Verlagshaus Ringier: Der CEO Marc Walder hat beim «Blick» nichts mehr zu sagen». Benini/Müller berufen sich diesmal auf «verlässliche Quellen». Laut denen solle «Blick»-Oberchefredaktor Christian Dorer nun direkt in publizistischen Belangen Michael Ringier unterstellt sein, in geschäftlichen Angelegenheiten der Dame mit der extrabreiten Visitenkarte Ladina Heimgartner.
Auch die Ernennung oder Absetzung wichtiger Chefredaktoren behält sich der Verwaltungsrat selbst vor, Walder habe da nicht mehr zu sagen. Ist das so?
Bei allem Triumphgeheul: Walder ist weiterhin Mitbesitzer und Protegé und designierter Nachfolger von Michael Ringier, damit auch künftiger Präsident des VR. Eine solche Figur wird nicht einfach wegen eines Gewitters abgesägt. Geflissentlich wollen alle den letzten Satz in Ringiers Hausmitteilung ignorieren: «Der Verwaltungsrat steht uneingeschränkt hinter dem CEO und Miteigentümer Marc Walder.»
Zudem hat Walder, was im Verlag eher selten ist, auf wirtschaftlichem Gebiet Pflöcke eingeschlagen, das Haus Ringier diversifiziert, an die Mobiliar-Versicherung geflanscht und eng mit dem mächtigen Springer-Verlag verflochten.
Die Familie Ringier ist längst nicht mehr alleine Herr im Haus, eine Personalien wie die von Walder, da darf auch Mathias Döpfner oder gar Friede Springer ein Wörtchen mitreden. Also sollten hier nicht zu früh Nachrufe auf Walder erscheinen.
Das zweite Problem: who’s next? Prädestiniert für die Machtübernahme wäre Heimgartner. Frauenbonus, bislang skandalfrei gesegelt. Das Problem ist allerdings: alleine mit dem Wort «Resilienz» kann man kein grosses Verlagshaus führen. In ihren wenigen öffentlichen Auftritten war sie noch ungeschickter als Walder letzthin, intern hat sie auch noch keine Pflöcke eingeschlagen oder Höchstleistungen erbracht, also kommt sie wohl höchstens als Frau am Fenster in Frage.
Dass man gegen aussen nun markieren muss, dass vor allem der «Blick» «unbeeinflusst» sei, ist klar. Ob allerdings Walder, FAM, Ringier oder sonst jemand der Chefredaktion den Tarif durchgibt, was zu schreiben und zu meinen sei, ist doch völlig egal.
Das wäre es auch bei den anderen Verlagen.
Wenn etwas fürs Publikum lehrreich ist in diesem Schlamassel: wieder einmal entlarvt sich die Mär der unabhängigen, nur journalistischen Kriterien gehorchenden und ausschliesslich den Interessen der Leser dienenden Medien. Das war schon immer ein Märchen und wird es auch immer sein.