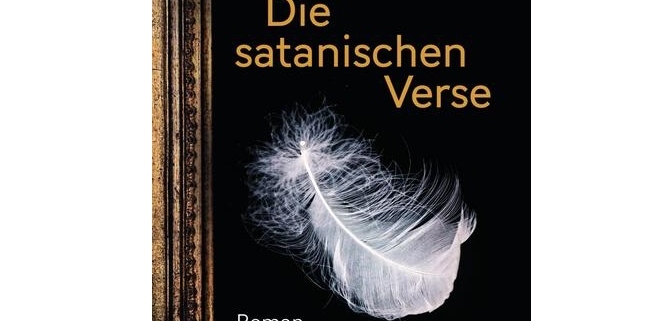Was macht man, wenn eine Story wehtut? Man bestellt den Weichspüler.
Der Langzeit-Chefredaktor der «Bilanz» wirkt immer freundlich und konziliant. Das kann aber täuschen, denn er schlägt auch gnadenlos zu. So klatschte er in der Oktober-Ausgabe den Versagerrat Urs Rohner aufs Cover:

Was Schütz von der Performance des ehemaligen CS-Bosses hält, das fasst er knackig zusammen:

Es ist eine Abrechnung und Hinrichtung: «Die Krise ist das schlimmste Führungsdebakel der Schweiz seit dem Swissair-Grounding.» Nicht nur das, von Schuldbewusstsein, Zur-Verantwortung-Ziehen oder gar finanzieller Wiedergutmachung könne bei Rohner keine Rede sein: «Kein Prozess, keine Zurückzahlung.»
Also kommt Schütz zum wenig schmeichelhaften Fazit schon im Titel der Story:

Das alles hat sich «weisse Weste» Rohner unredlich verdient, durch seine zwölfjährige Tätigkeit als VR-Präsident der einstmals stolzen Credit Suisse. Die Bank wankte in dieser Zeit durch eine Krise nach der anderen; während seiner obersten Verantwortung sank der Aktienkurs von über 60 auf unter 10 Franken, heute dümpelt er um die 4 Franken herum. Besonders peinlich für den Juristen und ehemaligen Chief Legal der CS: In seiner Amtszeit zahlte die CS 7,8 Milliarden Bussen.
Alleine im Steuerstreit mit den USA rekordhohe 2,6 Milliarden Dollar, während die UBS mit 800 Millionen davonkam.
Inzwischen ist Rohner abgetaucht, aus der Öffentlichkeit verschwunden, gibt keine Interviews, will keine Stellungnahmen abgeben, ist nicht mal mehr auf dem grünen Teppich des von seiner Lebensgefährtin begründeten Zürcher Filmfestivals anzutreffen.
Dabei könnte Rohner sich eigentlich sagen: 80 Millionen sind doch genügend Schmerzensgeld, da geht mir eine «Bilanz»-Klatsche doch schwer an einem gewissen Körperteil vorbei. Sagt sich Rohner aber nicht. Was tun, wenn einen ehemals mächtigen Mann eine Titelgeschichte schwer angurkt? Na, er organisiert sich eine andere.
Die muss natürlich auf einem gewissen Niveau stattfinden, also kommen die Organe seines Freundes Marc Walder eher weniger in Frage. Die NZZ würde sich niemals für eine Weisswäsche hergeben, das Verhältnis zu CH Media ist nicht ganz spannungsfrei. Ausserdem, in der «Schweiz am Wochenende» auftauchen? Das hält Rohner auch für unter seinem Niveau. Da bleibt dann nur noch eins:

Und wer kann ein solches liebedienerisches, höchstens mit pseudokritischen Einsprengseln versehenes Porträt schreiben? Denn das ist auch nicht gerade förderlich für die Reputation. Da kann es nur einen geben. Den obersten Qualitätshüter von Tamedia, den längst pensionierten Wendehals Res Strehle.
In seiner Jugend schrieb er emotionale Nachrufe auf Linksterroristen, daraus ist er längst herausgewachsen. Obwohl auch er seine fette Pension plus die Zusatzeinnahmen aus seiner angeblichen Qualitätskontrolle genüsslich verzehren könnte, greift er in die Harfe, wenn’s gewünscht wird.
«Republik»-lange 35’615 Anschläge darf er im «Magazin» schleimen, um den «gestrauchelten Hürdenläufer» Rohner zu rehabilitieren. Natürlich ist Strehle viel zu clever, eine reine Lobhudelei abzuliefern. Zu dramatisch und erinnerlich ist das Versagen Rohners.
Also wählt Strehle als naheliegend-banales Leitmotiv Rohners Sportart: «Hürdenläufer sind ganz besondere Menschen, Abenteurer und Schrittzähler zugleich.»
Dass Rohner den Einzug ins Halbfinale bei Europameisterschaft in Athen um 20 Hundertstelsekunden verpasste, sei «eine der wenigen Niederlagen im Leben des Urs Rohner, vielleicht die einzig wichtige, bis zu seinem Straucheln im März 2021 auf einem der höchsten Posten, die die Schweizer Wirtschaft zu bieten hat».
Der schmähliche Abschied ohne Décharge, Dankesreden oder wenigstens einer dem hinterlassenen Desaster angemessenen Entschuldigung, das war ein «Straucheln»? So geht schönschreiben.
Seither sei Rohner abgetaucht, aber natürlich im ganz grossen Sinne: «er teilt mit Friedrich dem Grossen das Motto «servir et disparaître».» Wow, Friedrich der Grosse, Rohner der Kleine, ein gemeinsames Motto.
Immerhin gibt Strehle dann offenherzig bekannt, was der Anlass für sein Schönschreibwerk ist: «Aber diesen Oktober hat ihn die Titelgeschichte des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» aus der Feder des Chefredaktors verärgert.» Also nix mit dienen und verschwinden, das will Rohner nicht auf sich sitzen lassen, das wäre ja ein Fleck auf der weissen Weste.
Schliesslich sei er noch geschäftlich aktiv: «In Zug hat er mit Vega Cyber Associates eine Sicherheitsfirma für Cybertechnologie eintragen lassen, deren Verwaltungsrat einem James-Bond-Drehbuch entnommen sein könnte. Sir Alex Younger sitzt darin, der ehemalige Chef weltweiter Operationen des britischen Geheimdienstes MI6, Vorlage des Agenten M im Film «No Time to Die».»
Leider versteht Strehle von der Geschäftswelt ungefähr so viel wie von James-Bond-Filmen und der Rolle von M darin. Aber wie dort folgt Strehle dem gleichen Drehbuch. Zuerst ein knalliger Anfang, dann die Retrospektive in Form eines – Leitmotiv! – Hürdenlaufs.
Sprung eins bis sechs wird nacherzählt, nicht ohne dass sich «der Autor dieser Zeilen» an die eine oder andere Begegnung erinnert, so viel Eitelkeit muss dann schon sein.
Aber welch eine Karriere darf hier aus der Kammerdienerperspektive beschrieben werden. Was für ein «Man in Full», wie ihn Tom Wolfe vielleicht genannt hätte. Aber das ist nicht Strehles Gehaltsklasse, er himmelt billiger: «Auch die Philosophie, Mutter aller Geisteswissenschaften, nimmt ihn in ihren Kreis auf: Katja Gentinetta, zuvor stellvertretende Direktorin des Thinktanks Avenir Suisse, lädt ihn am ersten Adventstag desselben Jahres zum einstündigen Gespräch in die «Sternstunde Philosophie» des Schweizer Fernsehens ein. … Auch diese Aufgabe meistert er unangefochten.»
Eigentlich ist Rohner auch noch ein unbekannter Held, wie er offenbar in einem zweistündigen Gespräch in seinem Büro im Seefeld verrät, obwohl er vom «Autor dieser Zeilen» nicht direkt zitiert werden will. Aber diese Heldentat muss natürlich erzählt werden, aus den Zeiten des Steuerstreits mit den USA:
«Rohner erwägt, den USA eigenhändig einen Stick mit CS-Kundendaten zu übergeben, sich danach anzuzeigen und die Verletzung des Bankgeheimnisses mit Notstand zu begründen. Er verzichtet dann darauf, der US-Justizminister begründet in der Folge die hohe Busse mit mangelnder Kooperation der Bank. Diese hätte die Schweizer Regierung zur Zustimmung zwingen sollen – ein seltsames Verständnis von Demokratie.»
Was für ein Mutanfall, welche Grösse, das wäre seit Winkelried die zweite Selbstaufopferung eines Schweizers gewesen. Aber leider, leider, er verzichtete dann bescheiden auf die Heldentat, wahrscheinlich wäre es Rohner unangenehm gewesen, dass man dann auf dem Paradeplatz ein Denkmal für ihn errichtet hätte.
Aber Strehle hat noch weitere gute Eigenschaften am Menschen Rohner entdeckt: «Noch gefährlicher als Finanzrisiken ist die Gefahr des persönlichen Abhebens in diesem Job: Da verdient einer vier Millionen im Jahr, hat jederzeit einen Privatchauffeur zur Verfügung und bei riskanteren Auslandsreisen Bodyguards. Urs Rohner benutzt den Privatchauffeur nur selten, den Firmenjet kaum. Er fliegt in jener Zeit mit eigenem Flugbrevet selber, eine einmotorige Cessna 172, ab dem Flughafen Kloten.»
Geradezu ein früher Berset, dieser Rohner. Chauffeur, Bodyguards, Firmenjet? I wo, bescheiden wie Otto Normalverbraucher eine einmotorige Cessna, höchstselbst pilotiert. Also an seinen Spesen kann der Niedergang der CS nicht erklärt werden.
Nun kommt’s aber knüppeldick, Milliardendesaster nach Milliardendesaster, immer unter der Verantwortung des Cessna-Piloten. Da muss Strehle einräumen: «Rohner kann diese beiden Hürden nur noch strauchelnd überspringen.»
Da wird Strehle zum Abtemperieren ganz nostalgisch: «Der Schreiber dieser Zeilen erinnert sich an die glanzvollen CS-Weihnachtsessen im vornehmen Saal des bankeigenen Hotel Savoy um die Jahrtausendwende.»
Aber auch die längste Schreibstrecke geht mal zu Ende, wie nähert sich der Hürdenläufer, der Schönschreiber Strehle dem Schlussspurt?
«Jetzt steht der ehemalige Leichtathlet vor der zehnten und letzten Hürde. Für ihn wird es der schwierigste Sprung: Er muss Fehler eingestehen, ein Wort der Entschuldigung würde helfen. Urs Rohner sieht dafür keinen Grund.»
Nun ja, vielleicht hätte er sich entschuldigen sollen. Aber er ist ein guter Mensch, will doch Gutes tun, nur lässt man ihn nicht: «Das versuchte er, als er im Schweizer Komitee der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Einsitz nahm. Aber inzwischen hat man ihn von der Liste entfernt. Ein anderes Mitglied hatte mit Rückzug gedroht, wenn Rohner dabeibleibe.»
Es ist halt schon schlimm, wenn so viele, von Schütz abwärts, Mensch und Werk nicht richtig zu würdigen wissen. Aber dafür gibt es doch Strehle. Den Worte-Zuckerbäcker, den Zuschwiemler. Mit diesem Stück hat er sich dafür qualifiziert, dereinst die Biographie Rohners zu schreiben. Wetten, dass?
Zuvor sind wir aber gespannt, ob und wie er diesen Schleimhaufen eines Artikels in seinem nächsten Qualitätsbericht erwähnen wird. Wir setzen auf «überhaupt nicht». Wettet einer dagegen?