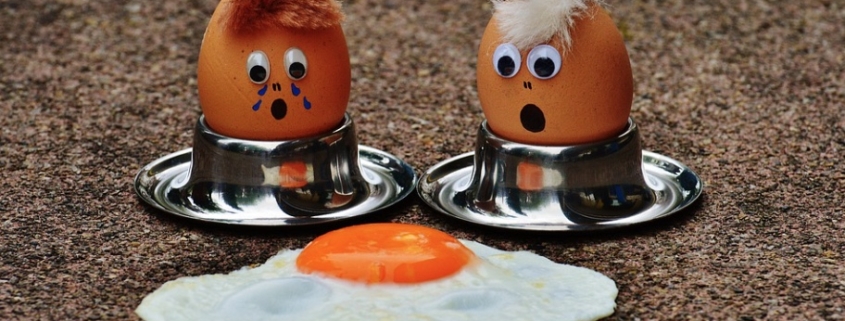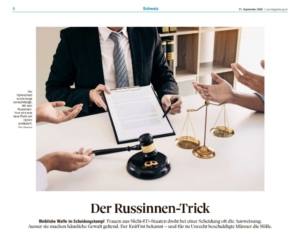Sommer-Sauglattismus
Was ist die Steigerung von überflüssig?

Et voilà. Wobei:

Mehr Sauglattismus geht nicht. Dreiwöchige Sommerpause, in der es niemandem auffallen wird, dass es das «NZZ am Sonntag Magazin» nicht geben wird.
Christoph Zürcher, der in seiner neuen Rolle als Blattmacher immer noch Zeit findet, Locken auf der Glatze zu drehen, muss natürlich zum Thema «Der Dadaismus des Besitzens» gleich mal David Hume zitieren, damit den Philosophen Lambert Wiesing einleiten. Muss man den kennen? «Bilder können, sie müssen jedoch nicht als Zeichen fungieren» – nein, nicht unbedingt.
Um dann mit «einem leicht Marie-Antoinette-haften Move» zu schliessen. Das war nun Geschwurbel auf Niveau WeWo-Bahnerth, also eines Zürcher eigentlich unwürdig.
Wenn wir schon bei Wiesing sind, auch Christopher Kulendran Thomase muss man nicht kennen, obwohl der irgendwas in der Kunsthalle Zürich ausstellt und ebenfalls dem Sauglattismus frönt: «An welcher Weggabelung im Leben befinden Sie sich gerade? – Müesli oder Granola?»
Nun kommt der grosse Auftritt von Patrizia Messner, gerade zurück aus Uruguay und Autorin eines Lobliedes über Gülsha Adilji (nein, die muss man auch nicht kennen). Nun hat Messner, was denn sonst, einen neuen Trend entdeckt. Das hat sie ziemlich exklusiv, so wie jeder Trend, den es eigentlich nicht gibt, eine Weltsensation ist.
Der Beweis:

Und der fotografische Beweis: «Vom Bauerndorf zum Digitalhub?»

Dazu fehlt dann vielleicht doch noch ein Mü, aber immerhin, Elektrizität hat’s. Was für ein Nonsens. Geht’s noch nonsensiger? Aber ja:

Mitte Juli noch Ferientipps geben? Für die Winterferien? Die Herbstferien? Nein. Geht’s noch nonensiger? Aber sicher, es gibt doch das Thema Flugscham, nicht wahr? Kann man aus dem noch was Originelles ausmelken? Man kann’s versuchen – und daran scheitern:

Und wir schreiben mit der Klosettbürste.
Geht’s noch nonsensiger? Der Magazin-Kenner weiss: aber ja, denn es kommt ja noch «Bellevue». «Atelier- und Projekträume im historischen Kasernenareal», wobei auch jeder Nicht-Zürcher weiss, dass das in Zürich liegt, ein Fotoband über «Freiheit, Sexualität und Queerness», ein «Sihl-Stuhl» von «Studio Krach» (banales Holz in «Ubootgeld», schlappe 848 Franken, gepolstert dann 1’242, dafür als Hocker bloss 437), dafür kriegt man schon ganz anständige Ensembles. Und schliesslich ein «Roboterschuh», an dessen Sinn sogar «Bellevue» zweifelt.
Geht’s noch nonsensiger? Nun ja, wenn man eine neue Pizzeria in Zürich so anpreist, dass sie Tomatensauce und Mozzarella «schon mal mit Vanillebéchamel oder Petersilie, Dill und Zitrone auf Ricotta» ersetze. Beliebt sei auch «die Variante mit veganem Lahmacun, der türkischen Spezialität, überzogen mit Mayo» (in der Ei hoffentlich nichts zu suchen hat).
Geht’s noch nonsensiger? Nun, wenn «Hat das Stil» aus drei Fragen besteht, das Magazin aber nicht auf drei zählen kann. Die Frage Nochmal-Zwei lautet zudem: «Wie viel Nacktheit darf im Schlafwagen sein»? Problem: ein offenbar dem Fragenden nicht bekannter Mitreisender habe in Boxershorts genächtigt und erst noch geschnarcht. Ersteres ist aber erlaubt, zweiteres kann man ihm schlecht vorwerfen.
Geht’s noch …? Oh ja, wenn Nicole Althaus in die Tasten greift: «Auf der Bühne war Freddie ein Naturereignis». Zu seinem Glück ist Freddie Mercury schon tot. Denn damit gratuliert Althaus zum 50. des «Debütalbums «Queen»». Denn eigentlich geht es Althaus nicht um den Sänger, sondern um sich selbst. Was sie damals anhatte, wie sie das Konzert im Hallenstadion erlebte, dass sie «als Geigenspielerin sozialisiert» sei. Ach ja, und etwas backfischartige Beschreibung der Musik kommt auch vor.
Allerdings gibt es hier eine gute Nachricht: damit hört das Magazin auf. Für diese Nummer. Für die nächsten drei Wochen. Aber vielleicht nicht für immer. Wobei es schwer vorstellbar ist, dass Eric Gujer einen solchen Quatsch schätzt.