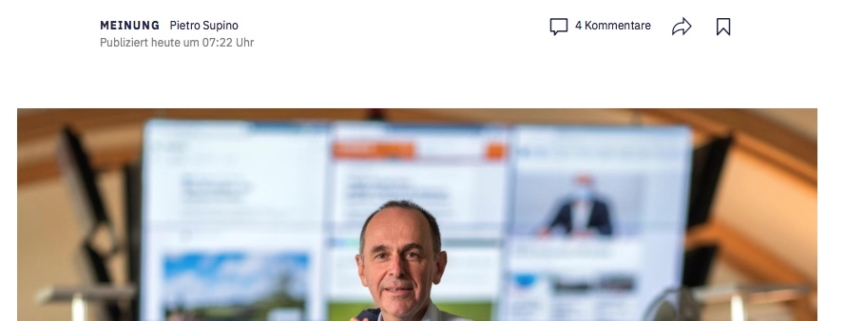Stoppt Campax!
Die Sammel-Plattform dreht durch. Genug von unwahren Kampagnen!
Der «Co-Geschäftsführer» Andreas Freimüller höchstpersönlich hat eine Beschwerde beim Presserat eingereicht. Er behauptet darin, der Beitrag «Die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen» verletze die Richtlinie 1.1. (Wahrheitssuche).
Und weil er der Chef ist, hat Campax gleich eine eigene Webseite gebastelt. Die Hetz-Plattform Campax fiel in der Vergangenheit schon durch diverse anrüchige Kampagnen auf. So polterte Mitarbeiter Urs Arnold: «Nazi-Fratzen hinter Folklore-Fassade». So entmenschlichte er die «Freiheitstrychler» die angeblich «offen rechtsradikales Gedankengut» verträten. Beweis: sie verwenden den alten eidgenössischen Schlachtruf «Harus», den auch die Schweizer Frontenbewegung missbrauchte. Das ist etwa so absurd, wie wenn man den Begriff «heilen» nicht mehr verwenden dürfte.
Schliesslich forderte Campax in einer Petition doch tatsächlich die Postfinance auf, den «Freiheitstrychlern» das Konto zu kündigen; ein klarer Rechtsbruch, denn auch Organisationen, die Campax nicht passen, haben Anspruch auf diesen Service Public. Im eigenen Laden geht’s hingegen weniger ordentlich zu, so sammelt Campax zwar fleissig Gelder, ist aber nicht Zewo-zertifiziert; eigentlich ein Must für jeden seriösen Spendensammler.
Und jetzt diese Breitseite gegen die Pressefreiheit. «Genug von unwahrem Sensationsjournalismus!», tobt Campax und holpert in mangelhaftem Deutsch los: mit dem Artikel über eine seriöse Umfrage an ETH und Uni Zürich «wurde zwanghaft probiert irgendwelche antiquierten Rollenbilder zu zementieren».
Zwanghaft? Dieser nicht nur bei Campax vorhandene bedingte Reflex, auf jede Störung des eigenen Weltbilds mit aggressiver Ablehnung zu reagieren, hat etwas Zwanghaftes. Statt sich an den Autor des Artikels oder vielleicht an seinen Chefredaktor Arthur Rutishauser zu wenden, steigt Freimüller gleich ganz oben ein:
«Deshalb fordern wir die Familie Coninx und Pietro Supino, den Verwaltungsratspräsident der TX-Group dazu auf, Massnahmen zu ergreifen, um den journalistischen Standard und die Qualitätssicherung der journalistischen Arbeit zu garantieren.»
Korrekte Verwendung des Akkusativs, Kommaregeln, solche fundamentale Massnahmen zur Qualitätssicherung sind Campax hingegen in der Aufregung scheissegal.
Wie ZACKBUM nicht müde wird zu beschreiben, liegt die Qualitätssicherung im Hause Tamedia tatsächlich im Argen.Aber sicher nicht bei diesem Artikel, der ja nicht auf dem Mist des Autors gewachsen ist, wie Campax insinuiert, sondern die Meinungen zweier hochqualifizierter Wissenschaftlerinnen wiedergibt, zweier Professorinnen, die eine amtierende Präsidentin der Gleichstellungskommission der Uni Zürich, die andere ihre Vorgängerin.
An deren Kompetenz und Unvoreingenommenheit sowie Sympathie für die Sache der Frau kann nun nicht gezweifelt werden (ausser man heisst Jacqueline Büchi, aber die Dame kann man ja nicht ernst nehmen «Finden Sie es anmassend, wenn ich als weisse Journalistin diese Fragen stelle?»). Also muss man auf den Autor losgehen und wilde Behauptungen aufstellen.
Es ist nun jedermann (selbstverständlich auch jederfrau und jedes***) freigestellt, sich von den Schlussfolgerungen einer wissenschaftlichen Untersuchung im eigenen Wohlbefinden in seiner Gesinnungsblase gröblich gestört zu fühlen. Es löst meistens Unwohlsein aus, wenn in einen Mief-Raum unter Luftabschluss plötzlich eine frische Brise weht.
Aber so durchzurasten, und das nicht zum ersten Mal, das disqualifiziert Campax endgültig. Völlig belegfrei behauptet die Hetz-Plattform noch: «Dieser Fall ist nicht der erste von sexistischer, sensationsheischender Berichterstattung. Aber jetzt ist es genug!»
Anders wird ein Schuh draus. Das ist nicht das erste Mal, dass Campax völlig Mass und Mitte verliert und zur bösartigen Unterstellungs-, Hetz- und Entmenschlichungsplattform wird. Aber jetzt ist wirklich genug. Die wenigen hereintröpfelnden Unterschriften unter diese Petition beweisen, dass selbst die hartgesottenen Gesinnungsgenossen von Campax diesen Unfug nicht goutieren.