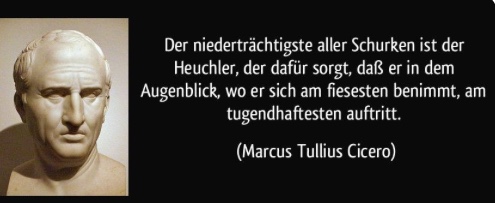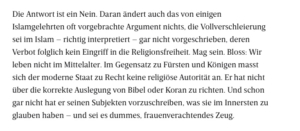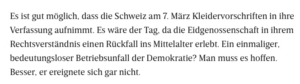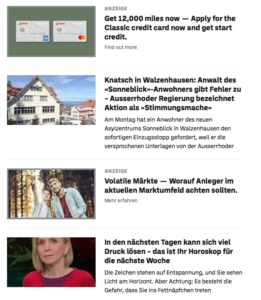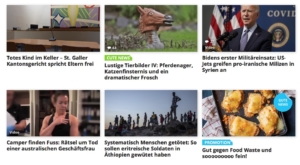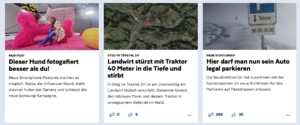Ho, ho Hollenstein
Der Lautsprecher von Jolanda Spiess-Hegglin hat wieder seines Amtes gewaltet.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Diesmal hat Pascal Hollenstein keine Sperrfrist gebrochen, um als Erster über neue Entwicklungen in der unendlichen Geschichte von Rechtshändeln berichten zu können. Er gibt einfach wieder, was ihm zugesteckt wurde, allerdings, so viel Qualität muss bei einer journalistischen Leiter nach unten sein, schräg und falsch.
Das Bundesgericht hat Massnahmen wieder in Kraft gesetzt, die vom Zuger Obergericht aufgehoben worden waren. Es geht um den Streit über ein noch nicht veröffentlichtes Buch einer Tamedia-Journalistin zum Thema feuchtfröhliches Zusammensein bei einer Zuger Politikerfeier.
Eine erste Instanz hatte zuerst superprovisorisch, dann als Massnahme der Autorin des Buchprojekts verboten, diverse Themenbereiche der Feier zu behandeln, bei der es zu intimen Kontakten über Parteigrenzen hinweg kam. Denn die daran Beteiligte mutmasst, dass die Journalistin ihre Persönlichkeitsrechte verletzen könnte.
Unerhörter Eingriff in die Pressefreiheit
Ein bedenklicher Eingriff in die Pressefreiheit, der von jedem anständigen Journalisten aus Prinzip scharf verurteilt werden müsste. Ausser, man gibt sich als Sprachrohr von JSH hin, betreibt nebenbei noch Konzernjournalismus (CH Media gegen Tamedia) und profitiert davon, alle nötigen Informationen brühwarm durchgestochen zu bekommen. Natürlich entsprechend parteilich gefärbt, denn das Bundesgericht selbst hat keine Medienmitteilung herausgegeben zu seiner vorsorglichen Massnahme.
Also behauptet Hollenstein:
«Bundesgericht stoppt umstrittene Passagen in geplantem Buch über Jolanda Spiess-Hegglin».
Für eine solche Verdrehung würde jeder Volontär streng gemassregelt, vielleicht sogar mit dem Ratschlag bedacht, sich einen anderen Beruf zu suchen. Denn davon steht kein Wort in der Verfügung.
Der einzige Sinn dieser Massnahme ist zu verhindern, dass einer von zwei möglichen Entscheide des Bundesgericht durch Fakten präjudiziert werden könnte. Denn ein Urteil steht noch aus. Stützt das oberste Gericht den Entscheid der Vorinstanz, dann kann das Buch erscheinen. Fällt es einen gegenteiligen Entscheid oder weist es den Fall wieder zurück, hätte die Möglichkeit bestanden, dass das Buch zwischenzeitlich erschienen wäre.
Damit wäre dann dieses mögliche Bundesgerichtsurteil «gegenstandslos» geworden, wie der Jurist so schön sagt. Und das wollen die obersten Richter natürlich nicht.
Ist Juristenfutter, aber eigentlich leicht verständlich. Wenn man will. Aber Hollenstein will natürlich nicht, also behauptet er den Unsinn, dass das Bundesgericht «umstrittene Passagen» gestoppt habe.
Von Unsinn zu Verdrehung
Das ist schon deswegen Unsinn, weil es noch gar keine Passagen gibt, die deswegen auch nicht umstritten sein können. Was hier als «Etappensieg» für JSH verkauft werden soll, ist nichts weiter als die verständliche Absicht des Bundesgerichts, keine seiner möglichen Entscheidungen durch die Macht des Faktischen präjudizieren zu lassen. Daher kommt diese Massnahme auch nicht überraschend; noch viel weniger kann man aus ihr auf ein mögliches Urteil schliessen.

Kein Grund, die Korken knallen zu lassen.
Auf noch viel dünneres Eis begibt sich Hollenstein, wenn er fröhlich aus der Eingabe der Anwältin von JSH zitiert. Die behauptet nämlich unverdrossen, dass bereits ein Manuskript vorliege und schon Verlagen angeboten worden sei. Zudem ginge daraus hervor, zitiert Hollenstein aus der Schrift der Anwältin:
«Der Inhalt sei, so eine in der Rechtsschrift zitierte Quelle, «brutal», stellenweise «diffamierend und herablassend». Jolanda Spiess-Hegglin würde «vom Manuskript hart getroffen; auch ihre Familie bleibe nicht verschont».»
Aber damit ist Hollensteins Feldzug noch nicht beendet: «Haben Tamedia-Mitarbeitende also hinsichtlich Existenz und Inhalt des Buches Justiz und Öffentlichkeit gegenüber Falschbehauptungen aufgestellt?» Diesen Verdacht lenkt Hollenstein auf die Autorin und den Oberchefredaktor von Tamedia.
Als Feigenblatt legt er drauf, dass das vom Anwalt der Autorin «bestritten» werde. Es ist zudem so, dass JSH damit bereits vor Obergericht baden ging, es schenkte diesen Behauptungen keinen Glauben. Alleine schon deswegen, weil die Identität dieser «Quellen» nicht offengelegt wurde. Eigentlich ein juristisches Unding, angebliche Belege vorzulegen, ohne deren Urheber zu identifizieren.
Stellungnahme? Aber nicht bei Hollenstein
Auch damit begibt sich Hollenstein ausserhalb primitivster journalistischer Benimmregeln. Er zitierte zwar kurz aus der Stellungnahme des Tamedia-Anwalts zuhanden des Gerichts, hielt es aber in der Eile und Hitze des Gefechts nicht für nötig, den persönlich angegriffenen Tamedia-Journalisten die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
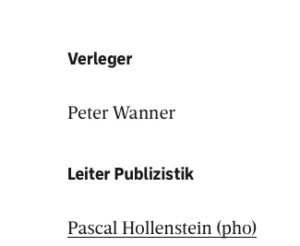
Nur einer könnte ihm Einhalt gebieten …
Hollenstein ist in dieser Sache Wiederholungstäter, der sich nicht als Vorbild für seine Redaktoren eignet. Höchstens als abschreckendes Beispiel. Seine bisherigen Untaten sind auf ZACKBUM schon ausführlich – und unwidersprochen – dargelegt worden. Aber offenbar lebt auch Hollenstein nach dem Prinzip: ist der Ruf erst ruiniert …
Natürlich bekam er Gelegenheit, zu diesem Artikel Stellung zu nehmen. Auch hier ist er Vorbild für Anstand und Fähigkeit zur Debatte: keine Antwort.
Immer unverständlicher wird allerdings, wieso Besitzer Wanner diesem Treiben weiterhin zuschaut.