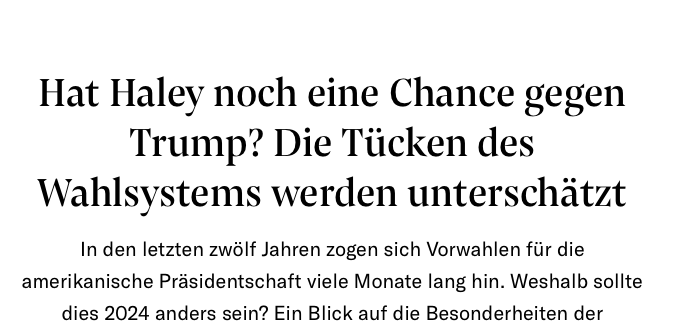Alles eine Frage der Effizienz
Heute wird es voll betriebswirtschaftlich. Eine Analyse des Stellenabbaus bei den Medienhäusern.
Von Kurt W. Zimmermann*
Die Frage war nur noch: Sagen wir es unseren Mitarbeitern vor Weihnachten, oder warten wir aus Pietät etwas zu?
TX Group, die frühere Tamedia, und CH Media sagten es ohne Umschweife: 85 und 150 Stellen werden hier abgebaut. Ringier wartete bis nach Neujahr, um den Abbau von 75 Stellen zu kommunizieren.
310 Stellen weniger in den drei grössten Verlagen der Schweiz. Es ist, in der Kombination, die bisher grösste Sparübung der Branche. Bei Stellenabbau ist das entscheidende Kriterium, wie sich der Umsatz pro Mitarbeiter entwickelt hat. Zu diesem Kriterium der Effizienz kommt man in drei Schritten.
Betrachten wir im ersten Schritt, wie sich die Mitarbeiterzahl (MA) bei den führenden Verlagen Ringier Schweiz, TX Group, CH Media und NZZ-Gruppe seit 2017 entwickelt hat, wobei wir bei CH Media jeweils die Zahlen von 2018 heranziehen, weil die Firma erst dann gegründet wurde. Zum Abgleich stellen wir die öffentliche SRG daneben.
2017 2022 +/–
Ringier CH 3006 2358 – 22 %
TX Group 3261 3380 + 4 %
CH Media 2000 1800 – 10 %
NZZ-Medien 800 821 + 3 %
SRG 4975 5518 + 11 %
Interessant ist der Fall Ringier Schweiz, also ohne die Aktivitäten in Osteuropa. Ringier hat hier in kurzer Zeit 650 Stellen abgebaut. CEO Marc Walder hat einen vorzüglichen Job gemacht und dies geschafft, ohne dass die Schnitte in Öffentlichkeit und Medien ein Thema geworden wären.
Auch bei CH Media fiel die Mitarbeiterzahl. Die Firma entstand aus der Fusion der AZ Medien mit den Regionalmedien der NZZ und beseitigte Doppelspurigkeiten.
Die TX Group und ihr Chef Pietro Supino andererseits, die als Sparteufel gelten, haben an Mitarbeitern zugelegt, unter anderem durch den Kauf der Basler Zeitung.
Und natürlich ist der Personalbestand bei der SRG seit 2017 explodiert, wenig erstaunlich, wenn die Kosten vom Steuerzahler gedeckt werden.
Betrachten wir im zweiten Schritt nun, wie sich die Umsätze der Medienunternehmen entwickelt haben.
2017 2022 +/–
Ringier CH 798 643 – 19 %
TX Group 974 925 – 5 %
CH Media 448 430 – 4 %
NZZ-Medien 213 247 + 16 %
SRG 1595 1549 – 3 %
Fast alle Medienunternehmen verzeichnen sinkende Erträge, am meisten bei Ringier. Es ist überall die Folge des gesunkenen Werbevolumens. Ausnahme ist die NZZ . Sie setzt auf das Geschäftsmodell Publizistik und dadurch auf Einnahmen aus dem Lesermarkt. Das macht sie weniger abhängig vom Anzeigengeschäft.
Im dritten Schritt ergibt sich nun der Umsatz pro Mitarbeiter. Es ist die Kennzahl für die Effizienz eines Unternehmens.
Ringier CH 265 000 273 000 + 8000
TX Group 304 000 274 000 – 30 000
CH Media 224 000 239 000 + 15 000
NZZ-Medien 266 000 301 000 + 45 000
SRG 320 000 280 000 – 40 000
Auffallend ist zuerst einmal, wie ineffizient die TX Group geworden ist. Ein Sparprogramm von Tages-Anzeiger bis 20 Minuten ist darum unausweichlich.
Unproduktiv ist im Vergleich besonders die CH Media. Sie ist es auch darum, weil sie über zwanzig Radio- und TV-Sender betreibt, wo die Margen schlecht sind. Generell sind die Kosten zu hoch, darum ist es folgerichtig, dass CEO Michael Wanner einen harten Personalabbau durchzieht.
Deutlich besser präsentiert sich die NZZ-Gruppe unter ihrem CEO Felix Graf. Auch hier wird zwar immer mal die eine oder andere Stelle eingespart, aber man kann das dank einer imposanten Effizienzsteigerung ziemlich locker nehmen.
Als Schlusspointe bleibt die SRG. Ihr Umsatz pro Mitarbeiter ist im freien Fall, weil immer mehr Angestellte das immergleiche Angebot produzieren. Es ist ein Absturz an Effizienz. Aber das scheint SRG-Chef Gilles Marchand egal zu sein.
Effizienz im freien Fall: Immer mehr Angestellte produzieren bei der SRG das immergleiche Angebot.
*Die Kolumne erschien zuerst in der «Weltwoche» Nr. 3/24. Mit freundlicher Genehmigung des Autors.