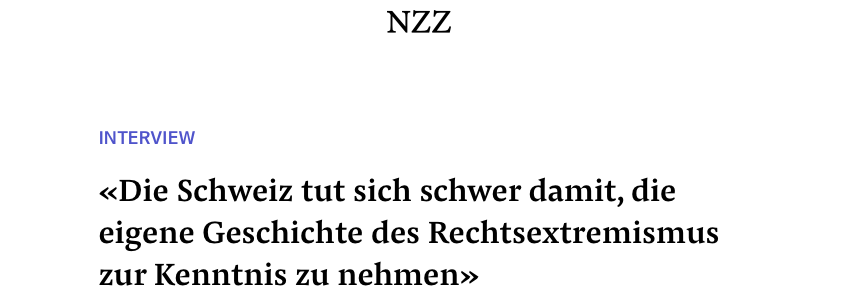Wie er seinen Hintern retten will
Wie flickt man ein eigenes Fehlverhalten?
Cédric Wermuth liefert ein Musterbeispiel, wie man mit der Instrumentalisierung der Medien versuchen kann, Schadensbegrenzung vorzunehmen.
Als der SP-Co-Präsident ankündigte, dass er sich eine zweimonatige Auszeit nehmen werde, war das Medienecho verhalten. In der Schweiz respektiert man weitgehend das Privatleben von Politikern. Als Nathalie Rickli oder Jacqueline Badran Auszeiten nahmen, um einem Burnout zu begegnen, bekamen sie von Freund und Feind eigentlich nur Sympathieadressen.
Auf diesen Bonus hoffte offensichtlich auch Wermuth, bevor er mit Kind und Kegel in die Ferne flog. Seine Rückkehr gestaltete sich dann weniger idyllisch. Denn auch mit feinster Rabulistik lassen sich ein paar Tatsachen nicht wegplappern.
– Wenn jemand Flüge innerhalb Europas verbieten will, selbst aber für ein verwackeltes Selfie mit dem damaligen Wahlsieger Olaf Scholz nach Berlin jettet, hat er ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn er dann mit der ganzen Familie nach Vietnam und auf die Philippinen fliegt, statt es mit einer Radtour in den Schweizer Bergen zu probieren, verschärft sich das ungemein.
– Mit den ausgedehnten Familienferien hat Wermuth offensichtlich gegen Bestimmungen des Parlamentsgesetzes verstossen, das Absenzen nur aus wichtigen Gründen oder wegen Krankheit erlaubt.
– Mit seiner Lustreise verarscht Wermuth seine Wähler, die von ihrem SP-Nationalrat politische Leistung für sein üppiges Honorar erwarten.
– Mit seinem Familientripp verarscht Wermuth die Schweizer Steuerzahler, die das schliesslich finanzieren und selbst nur davon träumen können, mal zwei Monate bezahlten Urlaub zu machen.
Also ist die Ausgangslage eher kritisch bis bewölkt. Was tun? Schadensbegrenzung ist das Stichwort; ein «jetzt rede ich», ein «ich breche mein Schweigen» ist angesagt. Natürlich in einem gesinnungsfreundlichen Umfeld, wo kritische Fragen als Wattebäuschchen daherkommen und man Wermuth mit schwiemeligen Antworten («Herr Glarner darf selbstverständlich seine Meinung zu meiner Auszeit haben») davonkommen lässt.
Hier darf sich Wermuth ungestört ausjammern:
«Mehrere Ratskolleginnen und -kollegen, gerade auch bürgerliche, haben mir zu meinem Mut gratuliert. Viele haben mir gesagt: Ich könnte das nicht. Es hat mich etwas traurig gestimmt, dass offenbar viele Angst haben, das Gesicht zu verlieren, nur weil sie sich Zeit für sich und ihre Familie nehmen. Das halte ich für eine grauenhafte Vorstellung von Führung und Leben.»
Hat er sich damit, dass ihm Jacqueline Büchi bei Tamedia einen Schaumteppich für die weiche Landung auslegte, einen Gefallen getan? Funktioniert die Nummer ich bin ein sensibler woker Mann, der dem männlichen Führungsprinzip eins in die Fresse haut?
Zumindest Tamedia weiss er dabei auf seiner Seite. Der Gesinnungsgenossenkonzern legt sogar noch nach: «Eine mehrmonatige Auszeit, wie sie sich SP-Chef Cedric Wermuth genommen hat, ist auch bei Führungspersonen in der Wirtschaft nichts Aussergewöhnliches mehr», weiss Isabel Strassheim, die sich sonst nicht immer sehr glücklich um die Basler Chemie kümmert. Allerdings muss sie einräumen: «Normalerweise ist ein Sabbatical ein unbezahlter Sonderurlaub.» Hat also mit den bezahlten Ferien Wermuths eigentlich nichts zu tun. Der übrigens Co-Präsident ist und Cédric heisst.
Allerdings ist die Reaktion der Leser in den Kommentarspalten gelinde gesagt durchwachsen. Die NZZ hält sich bislang vornehm zurück und nimmt (noch) keine Stellung. CH Media aus den Stammlanden Wermuths schleimt sich nicht gerade so ein wie Tamedia, gibt aber Wermuth das letzte Wort gegenüber dem anderen Aargauer Andreas Glarner und endet die Berichterstattung spitz: «Auch bei Glarners Partei, der SVP, entscheiden Fraktionsmitglieder ziemlich frei, ob sie an Kommissionssitzungen teilnehmen oder sich vertreten lassen.»
Also die auch, wieso wir dann nicht, und überhaupt.
Ganz anders sieht es lustigerweise beim «Blick» aus, der angeführt vom alten Meinungsträger Frank A. Meyer zunehmend kritisch gegenüber der SP wird. Hier darf sich der Leser aus der «Community» austoben, wird über den Vorstoss Glarners breit (und wohlwollend) berichtet.
Ist es Wermuth also gelungen, die Medien geschickt zu bespielen, sich sympathisch rüberzubringen, Verständnis für seine Familiensupersonderreise zu wecken?
Die Antwort ist klar: nein. Im Gegenteil. Das Geschleime im «Tages-Anzeiger» ist nicht hilfreich, sondern kontraproduktiv. Einfach deswegen, weil eine solche wochenlang Fernreise mit der ganzen Familie auf Kosten des Steuerzahlers und unter Vernachlässigung der Pflichten, für die er gewählt wurde, nicht vermittelbar ist. Zu weit von der Erlebniswelt der Bevölkerung entfernt. Ausserhalb der eigenen Gesinnungsblase nicht goutiert wird.
Wer behauptet, für den Werktätigen, der «um acht aufstehen muss» einzustehen, muss in seiner eigenen Lebensführung gewisse Grenzen akzeptieren. Eine Umweltaktivistin, die zur Umweltkonferenz nach Dubai fliegt, macht sich lächerlich. Ein Fluggegner, der mit der ganzen Familie nach Vietnam und auf die Philippinen jettet, auch.
Dabei hat Wermuth ein übliches Politikerproblem. Er ist so sehr von sich selbst überzeugt, dass er meint, jegliches eigenes Verhalten schönschwätzen zu können, das Klavier sensibler, inkludierender, woker Mann zu bedienen, bringe genügend Punkte.
Europäische Politiker haben bis heute nicht gelernt, worin US-Kollegen Meister sind. Fehlverhalten, auch schweres? Zuerst abstreiten, wenn es zweifellos nachgewiesen wird oder offenkundig ist: mannhaftes Hinstehen vor die Kameras und Mikrofone, Dackelblick aufsetzen und «ich bereue, ich entschuldige mich, ich habe mich und meine Wähler enttäuscht, ich werde es nie mehr tun, ich bitte um eine zweite Chance» knödeln. Klappt (fast) immer.
Hätte auch bei Wermuth funktionieren können. So aber hält er den Parlamentarierreisli-Skandal schön am Köcheln.