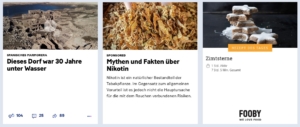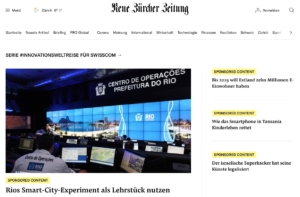Wahnsinns-PR
Volles Rohr für die Harley-Davidson der ZKB im «Blick».
Das ist mal eine erfolgreiche PR-Aktion. Die ZKB schafft es in Print und online ganz nach vorne beim Organ mit dem Regenrohr im Logo.

Online gleich noch ergänzt durch den Ratgeber «So musst du vorgehen, wenn du die Bank wechseln willst». Unverständlich, wieso nicht getitelt wurde «wenn du zur ZKB wechseln willst». Aber man kann ja noch nachlegen.
Kaum zu übertreffen ist die Schleimspur, die im Interview mit dem ZKB-Chef Urs Baumann hingelegt wird. Das fängt bei der Einleitung an:
«Vor den Fenstern des Konferenzraums blinken die Lichter der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung an der Zürcher Bahnhofstrasse. Zum Gespräch mit dem Chef der Zürcher Kantonalbank (ZKB) werden Weihnachtsguetzli von Sprüngli serviert. Das Angebot für einen (alkoholfreien) Punsch lehnen wir dankend ab.»
Fehlt nur noch, dass dem Journalisten ein Sparbüechli und ein Goldvreneli als Weihnachtsgeschenk überreicht wurde. Hier darf Baumann ungehemmt schwelgen: «Unsere Vision ist es, dass das Alltagsbanking bei uns kostenlos ist.» Da spricht der Weihnachtsmann persönlich, keine Frage. Am Bart arbeitet Baumann noch, aber nächstes Jahr dürfte das dann auch klappen.
Es muss herrlich sein, wenn Corporate Communication höchstens noch ein paar Glanzlichter auf das gesagte setzen muss: «… ist es unser Anliegen, dass auch die Kleinsparer davon profitieren können … alle ohne Zusatzbedingungen vom neuen kostenlosen Alltagsbanking profitieren können … substanzielles Dankeschön an unsere Kundschaft … wir haben viele Privatkunden dazugewonnen …» Ist das nicht etwas repetitiv? Ach was, wenn’s so schön ist und das Christkind im Raum schwebt …
Gibt es denn keine Wermutstropfen im alkoholfreien Punch? Nun ja, der «Blick»-Journalist müsste nicht unbedingt so aussehen wie ein «Blick»-Journalist:

Sonst noch was? Ach, nur Kleinigkeiten. ZKB-Zinsen auf einem Privatkonto: 0,00 Prozent. Jugendprivatkonto bis 25’000 Franken: 0,25 Prozent, danach 0,00. ZKB Sparkonto: bis 50’000 Fr. 0,85 Prozent, danach 0,25, ab 250’000 noch 0,00 Prozent. Eine ZKB Festhypothek, Laufzeit 10 Jahre, kostet dagegen 2,36 Prozent. Ach, Teuerung in der Schweiz im Jahr 2023: 2,2 Prozent. Das heisst, bei all diesen Angeboten kann der ZKB-Kunde zuschauen, wie seine Einlage abschmilzt. Macht er nicht Gewinn, sondern Verlust.
Aber he, wieso soll der «Blick» dem Chef der ZKB unangenehme Fragen stellen? Das wäre doch Journalismus, vielleicht gar vom Boulevard, und das will man (oder frau) nicht mehr. Schliesslich bekommt Baumann noch einen klitzekleinen Tritt ans Schienenbein im Kasten «Persönlich»: «Eines seiner Hobbys gehört allerdings nicht zu den umweltfreundlichsten: Der ZKB-Chef braust gern mal mit der Harley-Davidson über Landstrassen». Aber auch das wird abwattiert: Er «kommt zum Ausgleich dafür ab und zu aus der Seegemeinde Kilchberg mit dem Stand-up-Paddle zur Arbeit».
Vermisst man sonst noch was an dieser Lobeshymne? Schon, trotz angestrengtem Suchen findet man nirgends einen Hinweis wie «native ad» oder «sponsored content» oder gar «Publireportage».