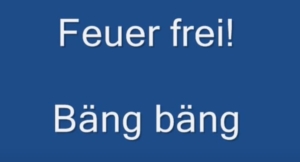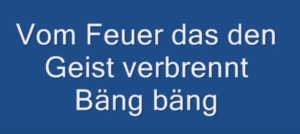Kommt nur drauf an, was. Wir probieren’s wieder mal mit Buchtipps zur aktuellen Lage.
Drogen, Kampf gegen Drogen, Drogenkartelle, die in Lateinamerika, auch in Asien, in Afrika ganze Landstriche, ganze Länder beherrschen. Wer die volle Härte der mexikanischen Drogengangster lesend erfahren will, dem sei die Trilogie von Don Winslow empfohlen. «Tage der Toten», «Das Kartell» und «Jahre des Jägers». Ein Monumentalwerk, an dem Winslow von 2005 bis 2019 gearbeitet hat. So nah an der Realität, wie Bücher nur sein können. So nah, dass es verwundert, dass Winslow noch lebt.
Aber das Schrecklichere lauert immer hinter dem Schrecken – und kann sich gut verstecken. Denn die schlimmste Droge zurzeit heisst «Fentanyl». Noch nie gehört? Schwerer Fehler. Dann sollten Sie unbedingt Ben Westhoffs gleichnamige Reportage darüber lesen. «Neue Drogenkartelle und die tödliche Welle der Opioid-Krise». 264 Seiten, die Ihnen auch das Fürchten lehren werden.

Denn Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, gehört also zur Familie der Morphine, und wird als Anästhetikum oder Schmerzmittel eingesetzt. Dabei ist es ungefähr 100 mal wirkungsvoller als reines Morphin. Schon die Berührung damit kann tödlich sein; Drogenhunde fallen schon mal tot um, wenn sie es erschnüffeln.
Diese ungeheuerliche Wirkpotenz macht Fentanyl so gefährlich. Schon Dosen im Mikrogrammbereich reichen für den Exitus; wenn es im Drogenhandel gestreckt, aber nur schon ungleichmässig verteilt wird, überlebt der eine, der es schnupft, der andere nicht.
Die Quellen des Fentanyl liegen nicht in Drogenfarmen, sondern in Labors. Und da sich China inzwischen auch auf dem Gebiet der Herstellung von Pharmaka zur Weltmacht Nummer eins aufgeschwungen hat, führen die Spuren der Herstellung und Verteilung über die ganze Welt.
Ben Westhoff, Investigativ-Journalist, ist diesen Spuren nachgegangen. Er schreibt für Rolling Stone, Guardian und auch das Wall Street Journal, über Drogen, Kultur und Armut. Herausgekommen ist das Ergebnis einer insgesamt Jahre umfassenden Recherche, die in den USA wie eine Bombe einschlug, als sie 2019 dort in Buchform veröffentlicht wurde. Auf Deutsch hat sich lediglich der kleine Hirzel-Verlag in Stuttgart darum verdient gemacht, kürzlich die deutsche Übersetzung vorzulegen.
Obwohl Fentanyl die «tödlichste Droge in Amerika» sei, sagt die US-Gesundheitsbehörde. Schlimmer als Crack, Crystal Meth, schlimmer als Heroin und alle anderen verschreibungspflichtigen Schmerzmittel aus der Familie der Opioide. Also lesen, damit man nicht mal wieder sagen kann, man habe von nichts gewusst. Denn das Buch ist bester US-Journalismus: souverän recherchiert, umfassend, und gleichzeitig spannend wie ein Krimi geschrieben. Allerdings ein wahrer Krimi.
Wie halten wir’s mit Gewalt?
Gaza, Israel, Gewalt. Afghanistan: Gewalt. Sprachgewalt, rassistische Gewalt, männliche Gewalt, es gibt kaum einen Begriff, der so inflationär verwendet wird. Nur: was ist Gewalt eigentlich genau? Ist sie nur physisch, gibt es auch strukturelle Gewalt, kann sich Gewalt verkleiden, bleibt aber dennoch Gewalt?
Dietrich Schotte will Klarheit in dieses zu Brei geschlagene Wort bringen; mit seiner «Philosophischen Untersuchung zu einem umstrittenen Begriff». Forschungsergebnisse, Definitionen, welche Kriterien taugen für die Begriffsbestimmung, welche nicht.

Schotte unterrichtet in Leipzig Grundschuldidaktik in Fach Deutsch. Wer dieses kluge methodische, belesene Werk zur Kenntnis nimmt, muss seine Schüler beneiden. Seine Definiton von Gewalt: «absichtliche, schwere Verletzungen von Lebewesen gegen ihren Willen». Von Einzeltätern oder im Rahmen von Institutionen, in «Räumen der Gewalt».
Gleichzeitig spricht sich Schotte gegen die «begriffliche Entgrenzung» aus, also das Wort Gewalt so beliebig zu verwenden wie heutzutage auch Faschist oder Rassist oder Nationalist. Obwohl sich Schotte um einen möglichst einfachen Plauderton bemüht, stellt das Thema selbst gelegentlich durchaus gewisse Anforderungen auch an den Leser.
Aber richtig schwierig wie bei Kant oder Luhmann oder Habermas wird’s hier nie. 263 Seiten, deren Lektüre den Leser bereichert und viel sattelfester im Umgang mit diesem so oft missbrauchten oder instrumentalisierten Wort zurücklässt. Wie das Buch von Westhoff ist Schottes Untersuchung «Was ist Gewalt?» eher geräuschlos bei Klostermann in Frankfurt erschienen, in der Roten Reihe des Verlags. Das war 2020, als alle nur und ausschliesslich ins Mikroskop starrten und lernten, was COVID eigentlich ist.
Aber das wissen wir zumindest inzwischen, wie man den Begriff Gewalt sinnvoll und nicht als Totschlagargument verwendet, das kann man nun wirklich endlich bei Schotte nachlesen.
Wie halten wir’s mit dem Autoritären?
Mit einem weiteren Gummibegriff befasst sich Anne Applebaum: «Die Verlockung des Autoritären». Die US-amerikanische Historikerin mit starken Wurzeln in Polen (ihr Mann ist der ehemalige polnische Aussenminister) geht der Frage nach, wieso nicht nur die Altlinke, sondern auch die neue Rechte so viel Lust auf autoritäre Strukturen hat. Auf einen gewissen Führerkult. Wobei zum Beispiel Donald Trump sicherlich nicht denunzierend mit Adolf Nazi direkt verglichen werden kann. Aber wie viele weitere autoritäre Galionsfiguren eint die beiden, dass sie ja im Wesenskern geradezu lachhafte Kretins sind. Der salbadernde und brüllende Hitler, der jeder Differenzierung abholde Trump, der niemals einsehen wird, dass die Welt nicht nur aus Siegern oder Verlierern besteht, und dass er nur meint, ein Sieger zu sein.

Applebaum definiert den Anhänger des Autoritären als Anti-Demokraten, sie fragt sich, wieso dieser Wunsch nach autoritären Strukturen, der Europa im letzten Jahrhundert zweimal in den Abgrund geführt hat, immer wieder aufs Neue Anhänger findet. Quer durch Gesellschaftsschichten, ideologischen Ausrichtungen, unabhängig vom verniedlichenden Vokabular, das dabei verwendet wird.
Sie denkt auch über die willigen Helfershelfer in den Medien und in all den Beraterscharen nach. Vielleicht fehlt Applebaum etwas der ganz grosse philosophisch-historische Rucksack, um hier ein neues Standardwerk zu diesem Thema vorzulegen. Es sind andererseits auch nur 208 Seiten, die sie in einer gefälligen Mischung aus eigenem Erleben und Überlegungen füllt.
Besonders erwähnenswert ist, dass sich hier jemand zwischen alle Stühle setzt, keinesfalls den Fehler macht, innerhalb einer Gesinnungsblase nach Luft zu schnappen. Applebaum, obwohl sie natürlich eine Position hat – wie jeder denkende Mensch –, ist dennoch bereit, sich auf die Wirklichkeit, die Wirklichkeiten einzulassen. Also ein sehr gutes Gegenbeispiel zu all den leider immer mehr Platz beanspruchenden Lagerdenkern, die meinen, es sei Erkenntnisgewinn erzielt worden, wenn man mit den ewig gleichen Totschlagargumenten die ewig gleichen Gegenargumente niederzumachen versucht.
Was für ein stinklangweiliger Pipifax das ist, wenn in der «Republik», auch im «Nebelspalter», in der «Weltwoche», der WoZ, aber auch in der NZZ oder im Tagi wieder und wieder die Befriedigung der Vorurteile der eigenen Klientel viel wichtiger ist als der Versuch, zur fortschreitenden Erkenntnis etwas beizutragen.
Um dieses Elend wirklich zu erfassen, alleine dafür lohnt sich bereits die Lektüre dieses etwas lang geratenen Essays von Applebaum. Erschienen im Siedler-Verlag und immerhin dasjenige der drei hier vorgestellten Bücher, das am meisten Resonanz erfahren durfte.