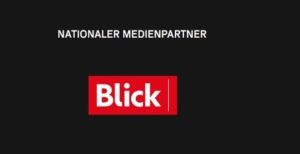«100 Liter Milch produziert»
ZACKBUM ist hart im Nehmen. Aber das war fast zu viel.
Das, was früher einmal «Das Magazin» war, heute aber nur noch so heisst, führt den Leser in nichts weniger als in das «Herz der Finsternis». So heisst ein Roman von Joseph Conrad, genial übertragen und verfilmt von Francis Ford Coppola mit «Apocalypse now».
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Da spricht Kurtz, niedergesäbelt, als Summe des Lebens, seines Erlebens die Worte «the horror, the horror». Niemals war Marlon Brando eindringlicher als in dieser Rolle. Nun fragt sich sicherlich männiglich und auch fraulich, wer war Conrad, was ist «Das Herz der Finsternis», und wer sind denn die anderen Figuren und Namen?

ZACKBUM fühlt mit.
Aber das wollen wir Paula Scheidt, Finn Schlichenmeier und Franziska* Schutzbach nicht vorwerfen. Scheidt ist Redaktorin beim «Magazin», Schlichenmeier Autor bei der «Zürcher Studierendenzeitung» (was besonders schmerzt, weil wir uns noch an den «ZS», den «Zürcher Student» erinnern, als deutsche Syntax und richtiger Sprachgebrauch noch etwas bedeuteten). Schutzbach hingegen ist «eine der wichtigsten feministischen Stimmen der Schweiz».

Doppeldeutiges im Lead, aber was soll’s.
Der breiten Öffentlichkeit wurde diese feministische Kreische durch Aussagen wie diese bekannt: «Keine Anzeigen mehr in der Weltwoche, Taxiunternehmen und Fluggesellschaften sollten keine Rechtsnationalen mehr transportieren, Veranstaltungsorte und Hotels keine SVP-Parteizusammenkünfte mehr in ihren Räumlichkeiten zulassen. Mikrofone können auch einfach ausgeschaltet werden. Fernsehsender müssen keine rechten Talkgäste einladen. Zeitungen nicht mehr über sie berichten.» Ausserdem outete sie sich als Antidemokratin,
indem sie Redeverbot oder Boykott für «rechtsnationale Politiker» forderte, selbst wenn «diese gewählt wurden».
Auf die Frage von «watson», ob sie als Taxifahrerin Roger Köppel am Strassenrand stehenlassen würde, antwortete sie: «Ja, ich denke schon.»
Eine ellenlange Würdigung der Antidemokratin
Anschliessend ruderte sie zurück, das habe sie nur satirisch gemeint. Zudem treibt sie sich im Umfeld der hassbereiten Kämpferin gegen Hass und Hetze im Internet, Jolanda Spiess-Hegglin, herum. Also eine, sagen wir mal etwas kompromittierte Stimme des Feminismus. Das hindert «Das Magazin» aber nicht daran, ihr neustes Buch mit einem ellenlangen Interview zu würdigen.
Der Titel lautet «Die Erschöpfung der Frauen. Wider die weibliche Verfügbarkeit». An die männliche Erschöpfung beim Lesen eines solch wirren Gesprächs denkt Frau aber nicht. Die (uralte) These in einem Satz: Durch Doppelbelastung sind Frauen erschöpft. Sowohl im Beruf wie im Privaten. Wie äussert sich das? Nun, Frau muss an den Geburtstag des Arbeitskollegen denken oder «im Büro die Blumen giessen».
Echt jetzt? «Genau», sagt Schutzbach, «es existiert also eine gewisse Gefahr auszubrennen, die klar mit historisch gewachsenen Geschlechterrollen zusammenhängt.» Dann gibt Schutzbach tiefe Einblicke in die privaten Aufgaben von Frauen: «Ein kranker Grossvater muss auch nachts zur Toilette begleitet werden, ein Kleinkind wird nie geplant krank, sondern immer unvorhergesehen.»

Frau als Opfer oder als Kunstwerk?
Wie wahr, und da sich der Mann in solchen Fällen einfach umdreht und weiterschnarcht, den kranken Opa ins Bett urinieren lässt, kümmert sich halt die Frau. Aber auch die Interviewerin verblüfft mit speziellen Ursachen von Erschöpfung:
«Manchmal erwähne ich, dass ich nach der Geburt meiner Zwillinge innerhalb von vier Monaten weit über hundert Liter Milch mit meinen Brüsten produziert habe. Alle reagieren überrascht.»
Wo liegt die Wurzel der Erschöpfung? Bei Adam Smith, ungelogen
Aber genug der Erschöpfung, wo liegen eigentlich die Wurzeln des Übels? Überraschung, bei Adam Smith. Echt wahr. Der war nebenbei der Begründer der modernen Wirtschaftslehre und schrieb mit «Der Wohlstand der Nationen» ein bahnbrechendes und bis heute nachwirkendes Werk. Aber aus feministischer Sicht ist etwas ganz anderes an seinem Leben bemerkenswert:
«Der Wegbereiter des heutigen Wirtschaftsliberalismus hat sein Leben lang bei seiner Mutter gewohnt. Sie hat alle Mahlzeiten gekocht, seine Wäsche gewaschen, das Arbeitszimmer geputzt. Er hätte merken müssen, dass seine Produktivität erst durch eine Frau möglich wird, die hunderte von Stunden gratis arbeitet. Aber nichts davon ist in seine Theorien eingeflossen.»

Kochte, wusch und putzte nicht: Adam Smith
Nun, genauer gesagt lebte Smith (1723 bis 1790) als Erwachsener von 1767 bis 1776 im Haus seiner Mutter. Da die Familie nicht unvermögend war, ist eher weniger anzunehmen, dass sich seine Mutter – und nicht Bedienstete – um Küche, Wäsche und Putzen kümmerten. Aber wieso soll man sich von der Realität feministisches Geschwurbel kaputtmachen lassen.
Aber gut, deswegen schrieb wohl Smith diese Werk und nicht seine Mutter, sie war einfach erschöpft. Wie kann man dem abhelfen? «Wir sollten Familienarbeit als Projektmanagement betrachten.» Aha, sonst noch Ratschläge? Aber immer: «Zwanzig Stunden Erwerbsarbeit pro Woche muss reichen.»
Wir gestehen alles
Nun müssen wir ein Geständnis machen. Eigentlich, Berichterstatterpflicht kann herausfordernd sein, wollten wir bis zum bitteren Ende durchstehen. Als dann noch Rollenbilder, Catcalling, Penisneid und all das Panoptikum der feministischen Uralt-Topoi kamen, verzichteten wir auch aufs Querlesen und beschlossen, dass unsere Erschöpfung nur durch den sofortigen Abbruch der Lektüre kuriert werden kann.

Gnadenlos erschöpfend: Franziska* Schutzbach.
Vielleicht wiederholen wir uns, aber: eine Redaktion, die nicht nur eine Titelgeschichte über Schamlippen zulässt, sondern auch einen solchen Sprachmüll seitenweise über den Leser ausgiesst, hat jede Kontrolle über den Inhalt ihres Organs verloren. Sie hat ihre eigentliche Aufgabe, die Leserbespassung oder zumindest -unterhaltung, völlig aus den Augen verloren. Und durch Leserquälen ersetzt. In einem Ausmass, um das sich eigentlich der Gerichtshof für Menschenrechte kümmern müsste.
*Red. Nach Leserhinweis korrigiert. ZACKBUM fordert seinen Redaktor auf, sich zur Strafe einen Monat lang Arthur Zeyer zu nennen.