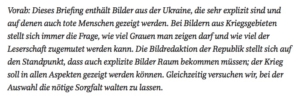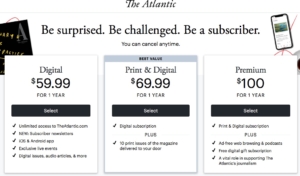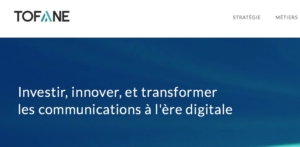Haut die Wagenknecht
Medien als Meinungsträger statt Berichterstatter.
Hand aufs Herz: wie viele Teilnehmer hatte die Friedensdemonstration letzten Samstag in Berlin? Waren es 13’000, wie die Polizei und viele Medien behaupten? Waren es 50’000, wie die Veranstalter und wenige Medien behaupten? Oder waren es «viele tausend» worauf sich Tamedia und andere Schweizer Medienkonzerne zurückziehen?
Es erinnert etwas an eine Anti-Coronapolitik-Demonstration zu Bern, als die Schweizer Medien nur knirschend und unter Druck einräumten, dass sie mit der Zahl der Teilnehmer schwer untertrieben hatten. Als ob es heutzutage nicht bis auf den Kopf genau möglich wäre, die Anzahl Teilnehmer an einer Manifestation zu bestimmen.
Aber das ist ja nur ein Aperçu im Rahmen der ausgewogenen Berichterstattung über die Ziele dieser Manifestation. Inzwischen haben, wie der Autor René Zeyer, fast 700’000 Menschen das «Manifest für den Frieden» unterschrieben, während Gegenmanifeste (und Gegenmanifestationen) lediglich ein paar Verkrümelte mobilisieren konnten.
Aber das alles ist für die Leitmedien kein Anlass, wenigstens korrekt über Absichten, Ansichten, Reden und Inhalte zu berichten. Um dann anschliessend den Senf dazu zu geben. Zunächst einmal geht es gegen die beiden Initiantinnen. Alice Schwarzer, die für die Emanzipation der Frauen im deutschen Sprachraum alleine mehr getan hat als alle sogenannten Feministinnen in der Schweiz zusammen, kann von ihrem Renommee her nicht so einfach weggeräumt werden. Also wirft man ihr vor, sie habe doch keine Ahnung von Politik und solle sich gefälligst weiter um Frauenfragen kümmern.
Das geht nun bei Sahra Wagenknecht schlecht. Also wird ihr von ihrer politischen und sozialen Genese in der ehemaligen DDR, über angebliche Verherrlichung des Stalinismus bis hin zu Moskauhörigkeit und dem Handeln als nützliche Idiotin Putins so ziemlich alles vorgeworfen, mit dem man eine inhaltliche Auseinandersetzung vermeiden kann.
Eine herausragende Rolle bei all diesen Denunziationen spielt auch, dass sich angeblich «vereinzelte Rechte und Rechtsradikale unter die Teilnehmer gemischt» hätten. Die Mitbegründer der deutschen Grünen, Petra Kelly und Gert Bastian, bekämen das grosse Kotzen, würden sie noch leben, wenn sie das Gewäffel des grünen Vizekanzlers Robert Habeck hören müssten: «Das ist kein Frieden, das ist eine Chimäre, die da aufgebaut wird, das ist eine politische Irreführung der Bevölkerung.»
Selbst aus ihrer eigenen Partei, der «Linken», wird Wagenknecht angegriffen, so behauptet die stellvertretende Parteivorsitzende: «Aber diese Demonstration hatte nichts mit linker Politik, gar mit linker Friedenspolitik zu tun.»
Besonders sauer stossen kriegerischen Friedenstauben Sätze von Wagenknecht wie dieser auf: «Wir wollen nicht, dass mit deutschen Panzern auf die Urenkel jener russischen Frauen und Männer geschossen wird, deren Urgrosseltern tatsächlich von der Wehrmacht auf bestialische Weise millionenfach ermordet wurden.»
Ds ist nun eine durchaus vertretbare Position, über die man, wie über den gesamten Inhalt des Friedensmanifests, trefflich inhaltlich streiten könnte. Stattdessen werden selbst die absurdesten Behauptungen aufgestellt: «Gleichsetzungen von Baerbock mit Hitler, wie sie unter den Teilnehmenden zu sehen waren, wurden nicht von der Bühne zurückgewiesen. In meinen Augen eine unfassbare Relativierung des Faschismus.»
Es ist also die Aufgabe einer Demonstrationsleitung, jedes einzelne Plakat einer Massendemonstration auf seine Korrektheit zu überprüfen und – sollte es durchfallen – von der Bühne aus zu kritisieren? Das könnte Anlass für eine saukomische Satire sein, wenn es nicht so beelendend mies und denunziatorisch wäre.
Nochmal Hand aufs Herz: welcher Leser könnte – nach Lektüre der Mainstreammedien und aufmerksamer Beobachtung der Berichterstattung im Schweizer Farbfernsehen – die wichtigsten Forderungen der Demonstration wiedergeben? Wer könnte eine Zusammenfassung der dort gehaltenen Reden machen? Wer kann behaupten, ein realitätsnahes Bild der politischen Verortung der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmer erhalten zu haben?
Positionen wie diejenige von Wagenknecht und Schwarzer, Ansichten der Hunderttausenden von Unterzeichnern und Zehntausenden von Demonstrationsteilnehmern können falsch sein, kritisiert werden, argumentativ in der Luft zerrissen.
Nur findet das nicht statt. Es wird auf den Mann, Pardon, auf die Frau gezielt, nicht auf deren Argumente. Es wird unterstellt, assoziiert, es werden angebliche Haltungen («moskauhörig») unterstellt. Ist die Vermutung abwegig, dass das alles aus Mangel an Gegenargumenten geschieht?
Ist die Vermutung abwegig, dass diese Art der Berichterstattung wieder ein Schlag ins Kontor ist, was das wichtigste Asset der Medien betrifft? Nämlich ihre Glaubwürdigkeit als Bote, wo sich der Botschafter mitsamt seinen Ansichten nicht wichtiger nimmt als die Nachricht selbst.
Denn Wertungen und Kritiken nimmt man doch nur demjenigen ab, der zuvor bewiesen hat, dass er in der Lage ist, ein Ereignis korrekt zusammenzufassen und seine wichtigsten Elemente dem Leser mundgerecht zu servieren. Aber wer die Nachberichterstattung schon mit diesem Lead beginnt, hat bereits verloren:
«Selbst in der eigenen Partei hagelt es Kritik für die prominente Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht mit ihrem sogenannten «Manifest für Frieden»».
Und die Zustimmung in der eigenen Partei? Und wieso «sogenannt»? Hat das auch nur im entferntesten mit handwerklich korrektem, professionellen, kompetenten Journalismus zu tun? Die Frage stellen, heisst sie beantworten.