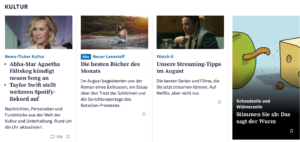Alles nur geträumt? Eine Archäologie am Berg.
Sibylle Berg hat ein bedeutendes Oeuvre geschaffen. Immer getragen von finsterer Weltsicht und artistisch dekorierter Depression.
Ob sie ihre eigene Biographie aufgehübscht, fiktionalisiert oder schlichtweg erfunden hat, ist eine lässliche Sünde. Wenn Journalisten ihr das alles abgenommen haben, ohne auf Widersprüchlichkeiten oder mangelnde Belege aufmerksam zu werden, wohlan. Lucien Scherrer von der NZZ hat die verdienstvolle Knochenarbeit geleistet, nachzugrübeln – um zum Ergebnis zu kommen, dass für vieles, für allzu vieles jeglicher Beleg fehlt; vom schweren Unfall über den Selbstmord der Mutter bis zur Dissidenz in der DDR.
Selbst über Geburtsdatum oder den Ort, wo Berg aufgewachsen sein will, gibt es verschiedene Angaben – von ihr selbst. Daher ist es absurd, sie damit verteidigen zu wollen, dass ihre Biographie privat sei und niemanden etwas angehe. Dahinter versteckt sie sich selbst, lässt das ihren Anwalt sagen – und nur rudimentär gebildete Journalistinnen wie Alexandra Kedves versuchen, das mit untauglichen Beispielen zu verteidigen: «Bezüglich ihres Privatlebens darf sie sich bedeckt halten, so wie das eine Menge Autorinnen und Autoren vor ihr taten.»
Kedves sollte es bei backfischartigen Schwärmereien «Kehle-Zuschnür-Momente, die hier für diese so gespaltene, so wunde Nation geschaffen wurden» in wackligem Deutsch bewenden lassen und nicht Grössen wie Thomas Pynchon für untaugliche Vergleiche missbrauchen.
Nun ist es unbezweifelbar so: in ihrem literarischen Werk, selbst in ihrer Biographie darf Berg Dichtung und Wahrheit vermischen, wie es ihr drum ist. Schreibt sie als Journalistin, sieht das ganz anders aus. Da gibt es nur die Wahrhaftigkeit – oder den Missbrauch des Vertrauens des Lesers, der ja dem Autor glauben muss, dass der gesehen, erlebt und recherchiert hat, was er schreibt.
Schauen wir uns die drei von Scherrer erwähnten Artikel von Berg einmal genauer an. Da wäre zum ersten «Der Totmacher», im November 1996 in ehemaligen Nachrichtenmagazin «Facts» erschienen. Copyright beim «Zeit Magazin», wir kommen darauf zurück. Fast 15’000 Anschläge über den polnischen Massenmörder Leszek Pekalski, der 57 Menschen umgebracht haben soll.
Berg verwendet einleitend diesen pseudo-literarischen Sound der Verdichtung, der guten «New Journalism» ausmacht, aber sehr schal wird, wenn er nicht gekonnt ist:
«Der Ort liegt da wie besoffen, wie im Koma liegt er da, in der Mittagshitze. Ein Nest in Polen. Eine staubige Strasse und Regen drauf, ganz offen, das Dorf zu säubern von versautem Leben. Eine ausgehöhlte Fabrik. Bekloppte Hunde kläffen, als gäbs da was zu bewachen. Links und rechts als Häuser getarnte Ruinen, als Menschen verkleidete Säufer. Wanken am Strassenrand, zum Kiosk, zum Saufen, die Beine nur von Gummistiefeln am Boden gehalten.»
Man weiss es ja, die Polen sind Säufer, die Lage ist hoffnungslos. So beginnt auch angeblich das Leben des Mörders: «Hier wird 1966 Leszek Pekalski geboren. Sein Vater ein debiler Traktorist, seine Mutter eine Magd, die Zeugungsnacht eine Vergewaltigung. Dreck, vom ersten Tag an.»
Dann kriecht sie in das Leben von Pekalski, als sei sie dabei gewesen: «Sitzt er in diesem Zimmer, auf dem Bett, und weiss die Feinde draussen, die Leere draussen. Und drinnen. Und wartet, dass die Zeit vergeht. Vergeht nicht, die Scheisszeit. So gern hätte er etwas für sich, das die Langeweile wegmachen würde. Fasst er sich an und weiss auf einmal, was ihm helfen würde.»
Aber Polen ist halt trostlos: «Kommt die Nacht, ist Polen verlassen. Alle sitzen in ihren Häusern, trinken.» Vielleicht ist Polen nicht verloren, aber verlassen und versoffen.
Dann überfällt Pekalski im Wald eine Frau, auch hier ist Berg dabei, sozusagen in ihm: «Endlich hat Leszek etwas, was ihm gehört. Er zieht sie aus, er untersucht die Frau. Sie wehrt sich nicht. Fein. Eine warme, weiche Frau. Das tut gut. Das riecht gut. Frauenhaar, Frauenkörper. Auf ihr liegen. Neben ihr. Bewegt sich nicht, kann er alles in sie stecken, kann er stark sein, Mann sein.»
Wenn es widerlich wird, ist Berg in ihrem Element, die Beschreibung der Vergewaltigung einer 13-Jährigen: «Sie lebt noch, als Leszek sie vergewaltigt. Sie lebt, trotz des Blutes, das aus ihrem Kopf kommt, trotz der Knochen, die im Hirn stecken. In ihrem Schmerz, ihrer Angst bis zum Wahnsinn, zerbeisst das Mädchen sich die Finger, bis das Weisse rausschaut.»
Dann fabuliert Berg ihre eigene Begegnung mit dem Mörder im Gefängnis: «Journalisten empfängt er nur, wenn sie ihm seine Wünsche erfüllen. Tüten voll Pornohefte, Schokolade, Kekse. Journalisten kommen viele, weil jeder gerne Mörder guckt. Ist ein gutes Grauen, dem Leszek gegenüberzusitzen, auf Armlänge, die Bewacher im Nebenraum.»
Auch sie habe seine Wünsche erfüllt: «Da schaut er lieber in die Tüte, wo die Schokolade drin ist und die Pornohefte.»
Nun gibt es hier ein paar Probleme. Berg will zum Beispiel auch wissen, wie es im Haus des Onkels des Mörders roch und aussah, als Pekalski dort einzog: «In einem heruntergekommenen Haus steht er, der Leszek, der versagt hat, in einem dunklen Flur, der stinkt, nach Moder, nach verfaulten Abfällen. In der guten Stube werden die Wände zusammengehalten von Heiligenbildern und Kruzifixen, und zu reden gibt es nichts. Der Onkel zeigt ihm ein Zimmer. Eine Stiege hoch, in den ersten Stock. Zwölf Quadratmeter gross. Tapete wellt von den Wänden. Pappe im Fenster, statt Scheiben. Ein Bett.»
Frage: Woher weiss Berg das? Ist sie dort gewesen? Hat’s Jahre später immer noch gestunken? Der Prozess war nur in kleinen Teilen öffentlich. Und da gibt es den Autor Jaques Buval, der aufgrund von Interviews mit Pekalski im Gefängnis (zu denen er ihm Schokolade und Pornohefte mitbrachte) später ein Buch über den Fall schrieb.
Diese mit Video aufgezeichneten Interviews spielten eine bedeutende Rolle im Prozess. Nun hat schon Truman Capote in seinem (im Übrigen furchtbar mäandernden) Werk «Kaltblütig» mit äusserster Genauigkeit die Morde (und die Mörder) einer vierköpfigen Farmerfamilie beschrieben. Allerdings als Rekonstruktion aufgrund von Akten, Zeugenaussagen und Gesprächen mit den Mördern.
Er erweckte dabei niemals den Eindruck, er sei selbst dabei gewesen; sozusagen als unsichtbarer Zuschauer oder versteckt im Hirn der Täter. Das ist in einer Reportage auf jeden Fall unstatthaft.
Die Beschreibung der Polen und Polens als hemmungslose Säufer in einem trostlosen Land ist an Rassismus und Diskriminierung schwer zu überbieten. In einer literarischen Verdichtung einer Reportage muss der Leser immer wissen, was faktisch unterlegt und was Ausdruck der literarischen Fantasie des Autors ist. Wer mit schalen und wohlfeilen Metaphern arbeitet, erweckt Misstrauen:
«Polen ist überall, der Sozialismus ist überall, und Stumpfheit liegt auf dem Land wie grauer Schmier.»
Diese Grenzen überschreitet Berg in ihrer «Reportage» mehrfach. Der Sound ihres Artikels ähnelt fatal den Werken von Tom Kummer oder von Claas Relotius. Diese zwei Serientäter haben mit ihren erfundenen oder fabulierten Geschichten dem Ansehen des Journalismus im Allgemeinen und des «Zeit Magazin» sowie des «Spiegel» im Speziellen schweren Schaden zugefügt. In beiden Fällen hatte die Aufdeckung ihrer Lügenstorys personelle Konsequenzen.
Wie heisst es doch heutzutage immer so schön: Im Fall von Sibylle Berg gilt die Unschuldsvermutung … Sie wird Gelegenheit bekommen, zu den hier aufgeworfenen Fragen (und zu einigen weiteren zu weiteren Artikeln) Stellung zu nehmen.

Weiss Berg, was in diesem Kopf vorgeht?