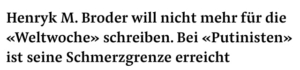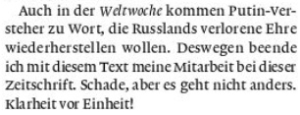Ein ganz Grosser hört auf.
«Gerichtsreporter sollen über das, was vor, am und nach dem Prozess passiert, berichten. Damit die Leserinnen und Leser wissen, dass es Gerechtigkeit gibt. Gerechtigkeit für die Opfer – denn die Täter bekommen meistens ihre verdiente Strafe. Aber auch Gerechtigkeit für die Täter, denen an einem Prozess gezeigt wird, dass es in einem Rechtsstaat Konsequenzen gibt, davor aber ein fairer Prozess stattfindet.»
Da ist alles drin, was Viktor (Vik) Dammann ausmacht. Als Mensch und als Gerichtsreporter. Er spricht und schreibt unprätentiös, weil er es nicht nötig hat. Er ist gegen alle Versuchungen gefeit, weil er sein Handwerk wie kein Zweiter beherrscht. Er hat – trotz seiner souveränen Schreibe der überlegenen Distanz – nie das Wichtigste verloren, was einen guten Gerichtsberichterstatter ausmacht: Empathie.
Er wusste immer, wo sein Platz ist. Nicht hinter dem Richterpult mit billigen Verurteilungen. Sondern im Publikum. Er wollte immer das, was auch den wohl grössten Gerichtsreporter des 20. Jahrhunderts ausmachte. Wie Gerhard Mauz wollte Vik sich selbst und seine Leser tief in die Abgründe von Verbrechen hineinführen. Er wollte verstehen, verständlich machen, erklären. Ohne die Taten zu billigen, aber auch ohne billige Urteile abzugeben.
Wenn die Lobesworte fehlen, spricht man schnell von einer Legende. Das war Vik nie, dazu wurde er nie. Denn es ging ihm nie um sich, sondern um die Sache. Mehr als 1000 Prozesse hat er in den 40 Jahren seiner Karriere verfolgt. Die sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, aber er hatte immer genügend Distanz, dass er weder am Guten im Menschen verzweifelte, noch den Leser mit tiefschürfenden Gedanken über das Böse belästigte.
Vik als Reporter war in erster Linie eines: ungeheuer fleissig und hartnäckig. Er gab sich nie mit der Oberfläche oder dem Schein zufrieden, er fragte nach, hakte nach, ging Spuren nach, arbeitete Widersprüche heraus, hatte ein detektivisches Gespür, wie es Polizei und Staatsanwaltschaft gut angestanden wäre.
Dann hat Vik noch eine weitere Eigenschaft, die ihn unersetzlich macht: er ist ein anständiger Mensch. Vertraulich hiess für ihn immer vertraulich, nie hat er eine Quelle missbraucht, nie hat er um der Sensation willen etwas verwendet, was er nicht verantworten konnte. So kamen im Lauf der Zeit zu seinen vielen, vielen Artikeln auch viel Ungesagtes, Nicht-Publiziertes hinzu. Auch die Strafverfolgungsbehörden wussten, dass man Vik vertrauen kann, dass er zwar wie ein Trüffelschwein (verzeih den Vergleich) der Story nachschnüffelt, aber niemals unlautere Methoden dabei verwendet.
Das führte einmal immerhin bis nach Strassburg, als das Schweizer Bundesgericht ihn verurteilt hatte, er habe sich der Anstiftung zur Amtsgeheimnisverletzung schuldig gemacht, weil er sich bei der Staatsanwaltschaft nach den Vorstrafen eines Täters erkundigt hatte – und Auskunft erhielt. Aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gab Vik recht – das Bundesgericht revidierte sein Urteil.
Gerichtsberichterstattung muss neben allem anderen exakt, genau und juristisch unangreifbar sein. Dafür muss der Berichterstatter im Recht und in seiner Anwendung sattelfest sein. Bei Vik könnte mancher Anwalt, mancher Kriminalist, mancher Staatsanwalt noch was lernen.
Eigentlich hätte er schon längst in Pension gehen können. Aber es war nie sein Beruf, es war immer seine Berufung, deshalb hat er bis 73 weitergemacht. Nicht zuletzt wegen einer schweren Erkrankung hört er nun auf. Der «Blick» wird noch leerer ohne ihn. Er wird keinen Nachfolger finden.
Nicht nur, weil der «Blick» nicht mehr ist, wie er sein sollte. Sondern in erster Linie, weil Vik halt Vik ist. Einmalig, unverwechselbar, unersetzlich. Wer sich für sein Wirken interessiert, «Das Böse im Blick», 14 Kriminalgeschichten aus seiner langen Karriere, ist im Orell Füssli Verlag erschienen. Es ist ein weiteres Armutszeugnis für diesen Verlag, dass es zurzeit vergriffen ist und antiquarisch besorgt werden muss.
Nun wird es – aller Wahrscheinlichkeit nach – keine neuen Gerichtsreportagen von Vik mehr geben. Schon 2016, viel zu früh, verstarb Attila Szenogrady, der rasende Gerichtsreporter mit Hut, der unablässig und ameisenfleissig und tadellos eine Reportage nach der anderen ablieferte.
Nun bleiben noch Thomas Hasler von Tamedia und Tom Felber von der NZZ. Aufrechte Kämpfer, aber sie werden wohl nie aus dem grossen Schatten heraustreten können, den Vik wirft.
Alles Liebe und Gute auf Deinem weiteren Weg, viel Kraft und dass Du das Leben noch so lange wie möglich und in kräftigen Zügen geniessen magst, mein Lieber. Denn Du hast Dich nicht versauern und verbittern lassen, sondern die Liebe für die schönen Seiten des Lebens bewahrt, obwohl Du so viel Schreckliches gesehen hast.
Du bist ein feiner, anständiger, kompetenter Mensch, damit gehörst Du im Journalismus leider einer aussterbenden Rasse an.