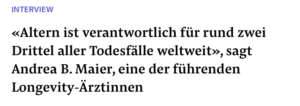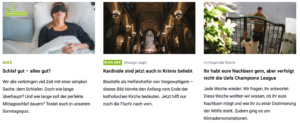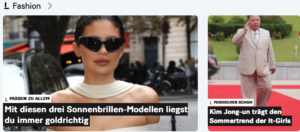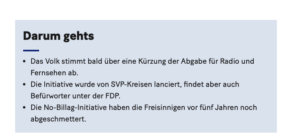Mal wieder blöd gelaufen: Schweizer sprechen nicht politisch korrekt.
Man merkt das Naserümpfen dem Artikel im «Tages-Anzeiger» deutlich an. Ein Drittel aller befragten Schweizer sagen in einer Meinungsumfrage, dass sie das Wort Zigeuner gerne und häufig verwenden. Obwohl der abgewirtschaftete Duden es als «diskriminierend» brandmarkt. Dabei musste schon die inzwischen entsorgte Tagi-Mitarbeiterin Aleksandra Hiltmann erschüttert festhalten, dass sich der Sohn von Django Reinhard selbst und gerne als «Zigeuner» bezeichnet: «ist das richtige Wort für mich». Das störte etwas beim Aufregen über das Z*-Schnitzel (Sie wissen, was gemeint ist).
Schlimmer noch, auch das M-Wort, das der Tagi nie mehr ausschreiben will, sei im Schwange; Schweizer sagen immer noch (sensible Leser, Augen zu und durch) Mohrenkopf. Sie sagen auch Asylant, obwohl doch angeblich «Asylbewerber» richtig sei. Was aber auch wieder falsch ist, Ihr Tagi-Pfeifen. DER Asylbewerber, merkt Ihr was? Asylbewerbender* muss das heissen. Und wann schafft Ihr endlich DER «Tages-Anzeiger» ab, womit Ihr mehr als die Hälfte Eurer Lesenden diskriminiert, hä?
Aber es ist alles noch schlimmer, «Nur 18 Prozent geben an, dass die «Gleichstellung der Geschlechter» ein drängendes Problem» sei. Deshalb antworten 75 Prozent der Befragten mit einem knallharten, männlichen, diskriminierenden Nein auf die Frage, ob sie auf «eine gendergerechte Sprache» achten würden.
Raphaela Birrer, Ihr Rat ist gefragt. Eigentlich nicht, aber sie gibt ihn doch in Form eines «Leitartikels». DER Leitartikel? Aber gut, sie fängt gleich rätselhaft an: «Die gendergerechte Sprache ist in der Schweiz nicht mehrheitsfähig. Trotzdem wird sie immer breiter verwendet. Darüber sollten wir reden – statt das Feld der SVP zu überlassen.»
Natürlich tappt ZACKBUM hier in die Falle, Frau und Logik zu schreiben. Immerhin ist Logik weiblich. Aber wieso die gendergerechte Sprache nicht mehrheitsfähig sei, gleichzeitig «breiter» verwendet würde, wobei dieses Feld nicht der SVP überlassen werden dürfe (verwendet ausgerechnet die denn gendergerechte Sprache)?
Offenbar nein, denn zunächst bekommt der Provokateur «Glarner und Konsorten» eins in die Fresse: «Extremisten wie er vergiften das gesellschaftliche Klima.» Aha, die SVP bewirtschafte eben dieses Thema: «Denn es geht der Partei um viel mehr als um ein paar Gendersterne. Es geht ihr um Macht und kulturelle Dominanz. Die geänderten gesellschaftlichen Verhältnisse – die Gleichberechtigung der Frauen, die Akzeptanz nonbinärer Geschlechter – widerspiegeln sich heute in der Sprache. Frauen und transsexuelle Menschen sind dadurch sichtbarer geworden.»
Ach, die eigentlich nur in den Medien und an verpeilten Lehrstühlen für Genderfragen geführte Debatte über «inkludierende» Sprache, über Vergewaltigungen wie Gender-Stern, Binnen-I und ähnlichen Unfug, dem auch und gerade der Tagi frönt (gab es da nicht mal eine drei Seiten lange Abhandlung des Kampffeministen Andreas Tobler, sekundiert von Hiltmann, wie man richtig zu gendern habe?), sei eine versteckte Machtfrage? Was für ein Unsinn, obwohl das Wort maskulin ist.
Abgedriftete Professoren, Kultur- und Erblinke, selbsternannte Genderforscherinnen sorgen dafür, dass sich viele Leitmedien immer weiter von ihrem Publikum entfernen. Damit Leser (ja, auch Leserinnen) verlieren, die sich weder durch solche Unsinnstexte, noch durch Sprachverhunzungen quälen wollen und auch allergisch darauf reagieren, erzogen und belehrt zu werden, dass sie nicht mehr Mohr sagen dürfen, sondern nur noch «M-Wort». Auch nicht mehr Neger, sondern angewidert N-Wort. Nicht einmal mehr Schwarzer, sondern nur noch PoC.
Die Mehrheit der Bevölkerung hat eben ein feines Gespür dafür, dass solche Sprachzensur, solche Erziehungsmassnahmen, solche Listen von Unwörtern zutiefst faschistisch sind. Ausgrenzend im Namen des Kampfs gegen Ausgrenzung. Ungut im Sinne des Guten.
Was fällt nun der Chefredaktorin des meinungsstarken und bedeutenden Tamedia-Konzerns ein, der täglich weit über eine Million Leser beschallt? «Dass sich die Sprache entwickelt, dass das Männliche nicht mehr als Norm gilt, ist grundsätzlich richtig.»
Galt das Männliche vorher als Norm? Interessant. Also, wie weiter?
«Die Deutungshoheit sollte weder bei (linken) Aktivisten noch bei einer (rechten) Partei liegen. Sondern in der Mitte der Gesellschaft. Führen wir also diese Diskussion – aber bitte mit Stil, Anstand und ohne ideologische Scheuklappen.»
Mit Anstand, aber ohne Scheuklappen? So vielleicht: SVP-«Programmchefin Esther Friedli hat das Thema als wilden Mix kulturkämpferischer, teilweise aus den USA importierter Parolen ins neue Parteiprogramm gehievt». Oder so: «Wenn Aufwiegler wie Glarner die Debatte pervertieren, können Menschen zu Schaden kommen. Glarner und Konsorten gehören von der eigenen Partei und der Wählerschaft gestoppt.»
Genau so stellen wir uns eine anständig und ohne Scheuklappen geführte Debatte vor. Woher Birrer zudem den Anspruch nimmt, aus der und für die «Mitte der Gesellschaft» zu sprechen, bleibt ihr süsses Geheimnis.
Vergleicht man dieses widersprüchliche Gestammel mit dem Essay von Birgit Schmid in der NZZ, dann wir einem wieder schmerzlich bewusst, in welchem intellektuellen Niedergang sich Tamedia befindet. Man muss da langsam von einem toxischen Betriebsklima sprechen. Denn es gibt ja noch ein paar intelligente Tagi-Redakteure. Deren Leidensfähigkeit aus Arbeitsplatzsicherung muss für die Leber immer ungesündere Auswirkungen haben.
Das gilt auch für «20 Minuten», den Veranstalter der Umfrage. Das Gratis-Blatt titelt doch tatsächlich so (nein, das ist kein Photoshop und keine Realsatire):

Nein, liebe vollbescheuerte Redaktion, die Mehrheit der Schweizer*Innen (wenn schon, gell?) sagt weiterhin Mohrenkopf, Zigeuner oder Asylant.
Und das hier könnte unter Verwendung anderer Bezeichnungen ohne Weiteres in jedem faschistischen Wörterbuch verpönter Begriffe stehen:

Liebe bescheuerte «20 Minuten»-Redaktion: das mit der Ableitung von «töricht» usw. ist ein Nebengleis, das der Kindersoldat in seiner Verrichtungsbox findet, wenn er mal «Herleitung Mohr» googelt. Immerhin fällt er nicht darauf rein, dass dann vielleicht auch die Mohrrübe (Deutsch für Karotte) abwertend sein könnte. Nein, Mohr kommt vom lateinischen Maurus (ausser, das Althochdeutsche hätte sich direkt im Griechischen bedient, was eine neue, aber falsche Theorie wäre).
Der Einfachheit halber bezeichnen sich Bürger von Serbien, Kroatien, usw. problemlos als Jugos, empfinden diesen Ausdruck (auf seine Verwendung und Betonung kommt es eben an) durchaus nicht als abwertend. Liebe bescheuerte «20 Minuten»-Redaktion: «Du Weisser», das kann je nach Kontext eine objektive Bezeichnung, ein Hinweis auf mangelnde Besonnung – oder ein Schimpfwort sein. Aber das entscheidet der Kontext, nicht das Wort (und schon gar nicht die Redaktion von «20 Minuten»).
Zigeuner, liebe bescheuerte «20 Minuten»-Redaktion, wird auch von Sinti, Roma, Fahrenden usw. gerne und problemlos selbst verwendet; wer’s nicht glaubt, kann gerne am jährliche Zürcher Zigeuner-Fest teilnehmen. Nein, das wird nicht von der SVP ausgerichtet und fand gerade mal wieder statt:

Und schliesslich noch Asylant. Wenn man der «Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus» glauben will, wäre das ein Ausdruck, den «rechtsstehende und fremdenfeindliche Organisationen» benutzen. Der «Duden», der auch nicht mehr ist, was er einmal war, versteigt sich zur Qualifizierung «oft abwertend». Was an «Asylsuchender» besser sein soll (abgesehen davon, dass es die weibliche Hälfte ausschliesst), erschliesst sich auch einem Dr. phil I der Germanistik nicht.
Nochmals zusammenfassend: macht nur so weiter. Mit solchem Blödsinn verliert ihr täglich immer mehr Leser und Käufer. Pardon, Lesende und Kaufende. Äh, Leser!Innen* und Kaufende***. Ach, verflixt, L*** und K***.
ZACKBUM hätte aber noch eine Frage aus persönlicher Betroffenheit an die Sprachpäpste von «20 Minuten»: Der Nachname des ZACKBUM-Redaktors René Zeyer fängt mit Z an. Z! Ukraine, Russland, Z. Wie soll er sich da verhalten? Einfach so tun, als wäre nichts? Seinen Nachnamen neu als Z-Wort bezeichnen? Mit Z*** unterschreiben? Hilfe!