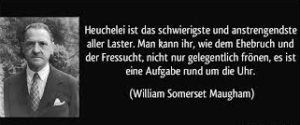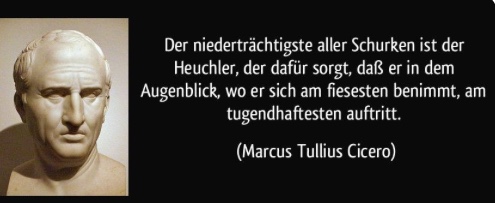Eine Portion Geheucheltes
Wenn einem Blatt wirklich alles egal ist.
Die «Sonntagszeitung» ist lauwarm entrüstet. Denn es geht ihm schlecht, dem Gletscher:
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Es geht ihm richtig hundsmiserabel, er schmilzt und schmilzt:

Die SoZ ist mit einer neuen Berufsgattung unterwegs, dem Gletscherbestatter (bald einmal von SRF verfilmt):

Gleich drei SoZ-Fachkräfte, sogenannte Glaziologen, interviewen den ETH-Glaziologen Matthias Huss: «Für einen Gletscher ist das ein Todesurteil.»
Wer spricht eigentlich dieses Todesurteil aus, wer ist sozusagen im Gerichtssaal dabei? Auch darüber berichtet die SoZ in aller ungehemmten Heuchelei:

Denn man gönnt sich ja sonst nix. Also darf die Co-Chefredaktorin, diese Torin, auf «luxuriöse Kreuzfahrt» gehen und schwärmen: «Die Scenic Eclipse kann dank ihrer Grösse und Bauweise in Reviere vorstossen, die anderen Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben. Für besondere Ausflüge reisen an Bord ein U-Boot und ein Helikopter mit.»
Launig politisch korrekt beginnt Priska Amstutz ihren Jubelartikel: «Einmal im Leben Jane Bond sein? Oder Alexandra von Humboldt?» Nein, eher eine Lohnschreiberin sein, «die Reise wurde von der Scenic-Gruppe unterstützt». Oder auf Deutsch: bezahlt. Weil sie sich das nie und nimmer leisten könnte: «In den Spa-Suiten gibt es von Philippe Starck designte Bäder. Im Yogaraum steht eine Wand aus Bergkristallen, in den Restaurants hängt vom Besitzerpaar ausgewählte Kunst.»
Gut zu wissen:
«Es ist kein steifer, hochnäsiger Luxus, der uns hier begegnet. Platz gibt es auf dem 170 Meter langen Schiff für maximal 228 Passagiere.»
Auch gut zu wissen, dass man auf dem Schiff sehr ans Ökologische denkt, der Koch «steht vor einem grossen Kühlschrank mit drei Glastüren und strahlt. Er zieht darin 20 verschiedene Kräuter und verhindert so Verpackungsmüll».
Denn was auf Gletschern nicht mehr möglich ist, nicht zuletzt wegen Dreckschleudern wie Hochseeschiffen, hier geht das noch: «Die Scenic Eclipse ist ein sogenannter Eisbrecher, so konstruiert und ausgerüstet, dass das Schiff durch zugefrorene Gewässer fahren kann.» Und wo’s kein Eis bricht, darf der Passagier mit dem Heli die Umwelt verschmutzen – oder mit dem U-Boot. Allerdings: Amstutz durfte, das geht aus dem Artikel hervor, nur einen kurzen Schnupperbesuch auf dem Schiff machen. Die Arme.
Natürlich breitet sie auch noch kurz ein grünes Deckmäntelchen aus und spricht ein Thema radikal offen an: «Die Kreuzschifffahrt gilt als grosse Klimasünderin.» Gilt?
Aber gemach und Entwarnung, sie hat tapfer vorgetragen und enthält dem Leser nicht die Antworten vor: «Auf diese Aspekte angesprochen, erhalten wir die Informationen, dass man auf der Scenic Eclipse viele kleine Hebel bemühe. Die Ausstattung des Interieurs erfolgt nur durch Partnerunternehmen, die über eine Öko-Zertifizierung verfügen.» Hurra, damit ist die Umwelt gerettet, die Gletscher schmelzen nicht mehr.
Könnte es ein Problem der Überbuchung geben, wenn sich nun SoZ-Leser, nicht abgeschreckt von den schrecklichen Nachrichten über die Gletscherschmelze, auf die Spuren von Amstutz begeben möchten? Kaum, denn der Aufenthalt in der Luxusklasse kostet, immerhin Verpflegung inbegriffen und «alle Landtransfers sowie 24-Stunden-Butlerservice», schlappe Fr. 1040. Pro Tag. Pro Person. Aber noch nicht in der Spa-Suite mit Philippe-Starck-Badewanne. Natürlich auch noch ohne Helikopter und U-Boot.
Der Luxus-Veranstalter unterscheidet dabei fein zwischen der Antarktis (13 Tage ab 13’658 €) und der Arktis (12 Tage ab 14’307 €). Wer’s gerne in der Spa-Suite geniessen möchte, wird 19’400 € los. Aber schlechte Nachricht: das «Owner’s Penthouse», gleich unter der Panorama-Bar, ist schon ausgebucht. Alle Fahrten, ausgenommen im Juli, auch.
Da Amstutz sowohl der Ausflug mit dem Heli wie mit dem U-Boot verwehrt blieb, hatte sie noch Zeit, das Essen im Zürcher Restaurant «Razzia» zu verkosten. Das hat nämlich ein neues Motto: «Beautiful Revolution». Revolution ist nicht mehr so das Ding von Amstutz, aber wunderschön, das sollte doch gehen. Also tafelt sie mit Begleitung (und natürlich auf Redaktionsspesen), und die beiden gurgeln zunächst zwei Apéros runter: «Meine Begleitung wählt einen «Yuzu Paloma» (Tequila, Grapefruit und Yuzu, 16.50 Fr.), ich erhoffe mir vom Cocktail namens «Le Fizz» (Wodka, Holunderblütenlikör, Limetten und Minze, 16.50 Fr.), dass er den versprochenen strukturellen Wandel einläutet, der per Definition mit einer Revolution einhergeht. Vielleicht ist das etwas viel verlangt, aber die Drinks schmecken beide sehr gut.»
Offenbar waren die Nachwirkungen nicht zu unterschätzen, bei diesem betütelten Geschreibsel. Nun aber zum Mahl: «Mein Gegenüber kostet als Vorspeise eine grosszügige Portion Zander-Ceviche mit Gurkenjuice, Sanddorn, Dill (26.50 Fr.) und ist begeistert.» Nun muss natürlich auch hier eine Prise Kritik her: «Die einzelnen Bestandteile des Chickenkatsu (41.50 Fr.), also eine Art paniertes Pouletfilet mit japanischer Currysauce und jeweils separat serviertem Sushireis und Weisskohl-Apfel-Salat, verbinden sich nicht ganz zu einem abgerundeten Gericht, schmecken aber für sich genommen gut.»
Das ist doch mal eine kenntnisreiche Gastro-Kritik, von der sich GaultMillau noch eine Scheibe abschneiden könnte. Beziehungsweise, die Gourmet-Fibel würde es schütteln, wenn ein solcher Bericht eingeliefert würde. Ungeniessbar, wäre das Urteil. Aber im Sparjournalismus kann nichts weg; wenn Tamedia schon mal mindesten 200 Eier für Amstutz begleitete Mahlzeit abdrückt, wird publiziert, was reinkommt. Abgesehen davon: wer würde es auch wagen, einer Co-Chefredaktorin die Butter vom Brot zu nehmen?
Qualitätskontrolle war gestern bei Tamedia. Den Heuchelei-Detektor hat man inzwischen aus Spargründen abgeschaltet. Anstand und gesunder Menschenverstand wurden auch rationiert. Daraus entsteht dann auch das hier:

Ein solcher Porsche-Nachbau kostet locker von einer Million US-Dollar aufwärts. Ein Schnäppchen, bei dem Wechselkurs zum Schweizerfranken. Geradezu obszön in dieser Reihe wirkt dann schliesslich dieser Ferien-Tipp:

Nö, der SoZ-Leser will sich lieber zuerst vom Anblick toter Gletscher kitzeln lassen, dann steigt er in den Porsche-Nachbau und glüht zum Eisbrecher mit Heli und U-Boot, wo er sich in der Spa-Suite erholt. Was sich dabei die angeblich politisch korrekte, grün und links gesinnte Redaktion so denkt? Die nie eine Gelegenheit auslässt, den Leser zum Sparen und zum Verzicht aufzurufen, ihm ein schlechtes Gewissen zu machen, welch ein schrecklicher Umweltsünder er sei.
Die denkt an den nächsten Zahltag, und daran, dass sie auch noch den übernächsten erleben möchte. Viel interessanter ist allerdings die Frage, was denn der Leser von dieser bodenlosen Heuchelei hält und wie lange er noch bereit ist, dafür zu zahlen, dass er zusammengestaucht und verhöhnt wird. Während sich die Co-Chefredaktorin zu einer kleinen Luxus-Sause einladen lässt, über die sie gebauchpinselt wohlwollend berichtet. Wie es sich für eine Lohnschreiberin gehört, die am Tisch der ganz Reichen kurz Platz nehmen darf und artig das Besteck von aussen nach innen benützt. Um dann Eis zu brechen. Während weiter vorne der Tod des Gletschers betrauert wird. Hand aufs Herz: wenn das nicht widerwärtig ist, was dann?