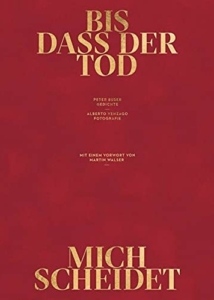Zum überraschenden Tod der Schriftstellerin Hilary Mantel.
Dieses Stück ist bereits in der «Weltwoche» erschienen. Es behält seinen Wert als Hommage und Würdigung einer ganz aussergewöhnlichen Frau.

Wer in die Geschichte blickt, schaut immer auch in sich selbst hinein. Weil da häufig nicht viel ist, entstehen dann historische Romane, die mit Mantel und Degen die innere Leere überdecken. Hilary Mantel aber hebt sie auf ein neues literarisches und intellektuelles Niveau. Mit messerscharfen Dialogen, historisch fundiert und souverän führt sie den Leser durch das Leben von Thomas Cromwell (1485 – 1540), dem genialen Berater des englischen Monster-Königs Heinrich VIII. Selten bedauert man mehr, dass «Wölfe» schon nach 768 Seiten, «Falken» gar nach 480 zu Ende ist. Warum?
Wer in die Geschichte blickt, will etwas Gegenwärtiges darin gespiegelt sehen. Die Zeit von Heinrich VIII hatte «Sex, Melodrama, Verrat, Verführung und gewaltsamen Tod. Was will man mehr», sagt Mantel. Aber wenn sie nur das beschreiben würde, wäre es lediglich in die Vergangenheit transponierte Gegenwart. Mantel führt uns jedoch in die Dunkelkammern der Macht am Hofe, in die schwarzen Seelen der Menschen hinein, wo nur wenig Licht und viel Düsternis ist. Wo sich ein Emporkömmling wie Cromwell, Sohn eines Schmieds, nur mit meisterhafter Verwendung von Charme, Bestechung und Einschüchterung ins Zentrum der Macht arbeiten kann. Mit Worten und dem Warten auf den rechten Moment. Was ihm am Schluss dennoch den Kopf kostet.
Lange blieb Mantel die gebührende Anerkennung verwehrt, denn «Wölfe» war bereits ihr zwölfter Roman. «Erst wartet man 20 Jahre auf einen Booker-Preis, und dann werden es gleich zwei», kommentierte sie die neuerliche Verleihung dieser angesehenen Auszeichnung im Jahre 2012. Bei der ersten, 2009, hatte sie fröhlich angekündigt, dass sie das Preisgeld für «sex and drugs and rock’n’roll» ausgeben werde.
Die damals 57-jährige englische Autorin weiss, was Ironie bedeutet. Denn seit vielen Jahren leidet sie unter Endometriose, einer chronischen und sehr schmerzhaften Erkrankung der Gebärmutter, die häufig und auch bei ihr falsch oder gar nicht diagnostiziert wird. Mantel wurde in ihrer Jugend hospitalisiert und gegen Depressionen behandelt. Erst Jahre später stellte sie sich selbst die richtige Diagnose, kämpft aber bis heute gegen die Folgewirkungen dieser auch mit Operationen nicht völlig therapierbaren Erkrankung. Solches Leid muss man wohl erlebt haben, wenn man so federleicht und tonnenschwer den Tod von Cromwells Frau beschreiben kann: «Als er am nächsten Morgen aufwacht, schläft Liz noch. Die Laken sind feucht. Er küsst ihren Haaransatz. Sie schmeckt salzig.» Cromwell geht nach unten, glaubt seine Frau zu sehen, die ihm folgt. «Aber sie ist nicht da. Er hat sich geirrt.»
Die Schriftstellerin weiss, was durchhalten bedeutet. Bereits 1985 veröffentlichte sie ihr erstes Werk, das genauso wie ihre folgenden Bücher weitgehend unbeachtet blieb. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaft arbeitete Mantel als Verkäuferin, Altenpflegerin, als Sozialarbeiterin in Afrika und begleitete ihren Mann, ein Geologe, für einige Jahre nach Saudi-Arabien. Sie beobachtete, analysierte, schrieb. Zuerst über die Gegenwart, dann über das Vergangene.
Wer in die Geschichte blickt, weiss, wie sie ausgegangen ist. «Aber wir wissen nicht, wie es gemanagt wurde», sagt Mantel. 1992 erschien ihr Roman «A Place of Greater Safety». Erst seit letztem Jahr liegt dieses 1100 Seiten umfassende Meisterwerk über die Französische Revolution unter dem Titel «Brüder» auf Deutsch vor. Georges Danton, Maximilien Robespierre und Camille Desmoulins begleitet sie auf deren Weg in den ersten Versuch der Neuzeit, in Europa ein Unrechtsregime nicht nur zu stürzen, sondern eine bessere, menschlichere Gesellschaft zu errichten. Eben «Liberté, Fraternité, Egalité».
Nun gibt es kaum ein historisches Ereignis, das so umfangreich und ausführlich beschrieben wurde. Von Historikern wie Albert Soboul, im Vorfeld von Schriftstellern wie Lion Feuchtwanger in seinem Roman «Die Füchse im Weinberg». Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Wir streiten uns bis heute über die richtige Interpretation dieser ersten modernen Revolution. Wie auch über alle, die ihr folgten. Wir kennen ihr Personal, Louis XVI, Marie-Antoinette, Jean-Paul Marat, Jacques-René Hébert, Antoine de Saint-Just, Lafayette, Napoleon. Ihre Begriffe, Sansculotten, die Jakobinermütze, die Trikolore, der Sturm auf die Bastille, die Guillotine. Selbst unsere politische Einteilung nach links und rechts stammt aus dieser Zeit.
Wer in die Geschichte blickt, muss etwas Neues herausbefördern, wenn er mit einem gewaltigen Roman den Leser begeistern will. «Gesetze schreiben bedeutet, die Kraft auszuprobieren, mit der Worte auf die Wirklichkeit einwirken», lässt Mantel Cromwell sinnieren. Genau das ist das Neue im Blickwinkel von «Brüder». Riss nicht Desmoulins mit einer Rede, einer Eingebung des Moments, die Pariser Bevölkerung zum Sturm auf die Bastille hin? Konnte nicht der wortgewaltige Anwalt Danton nur mit der Kraft des Sprechens bedeutende politische Entscheidungen dem Volk verständlich machen? Hatte Robespierre, schmächtig, kein guter Rhetoriker, mehr als die messerscharfe Präzisionslogik seiner Ausführungen, um im Nationalkonvent Minderheiten in Mehrheiten zu verwandeln, schon gefasste Beschlüsse umzustürzen?
Ginge es in «Brüder» nur um Redeschlachten, würden hier bloss Sprechpuppen auftreten. Aber Mantel verwandelt die historischen Figuren in Menschen aus Fleisch und Blut, die nicht nur in Dialogen in einer Intensität die Klingen kreuzen, wie es zuvor lediglich in Büchners Geniestreich «Dantons Tod» auf der Theaterbühne stattfand. Sondern die leben, lieben, leiden, zweifeln. Sich bereichern wie Danton, Frauenhelden sind wie Desmoulins, lebensunfähig wie Robespierre, der «Unbestechliche».
Wenn das alles wäre, hätte Mantel ein überbordendes Sittengemälde verfasst, eine aus einem Meer von historischen Fakten, Zitaten, Ereignissen kondensierte Erzählung. Aber sie will natürlich mehr, in ihrer Einleitung gibt sie einen Hinweis darauf: «Man mag sich beim Lesen fragen, wie Fakt und Fiktion auseinanderzuhalten sind. Als grober Anhaltspunkt mag dienen: Was besonders unwahrscheinlich klingt, ist vermutlich wahr.» Wobei sie ausdrücklich «keinen Anspruch auf Objektivität» erhebt.
Wer sich mit Geschichte beschäftigt, will daraus lernen. Gibt es Muster? Ist die Geschichte ein ewig drehendes Rad wie bei Shakespeare? Ist sie schicksalhaft vorbestimmt wie in der griechischen Tragödie? Oder gibt es Fortschritt, steht die nächste Generation auf den Schultern der vorangehenden, wie das die Aufklärung formulierte, durch deren Erkenntnisse die Französische Revolution erst möglich wurde? Wie kann man sie beeinflussen, dominieren sie Klassenkämpfe, welche Rolle spielen die Massen, der Einzelne? Wird die Geschichte von den Siegern geschrieben, während die Unterdrückten ihre andere Sicht der Geschichte finden müssen, wie das Peter Weiss in seiner «Ästhetik des Widerstands» darzustellen versuchte?
So viele Fragen, so wenig Antworten. Und da setzt Hilary Mantel wie die Eule der Minerva zu ihren Ausflügen in die Geschichte an. Die Eule beginne ihren Flug erst «mit der einbrechenden Dämmerung», schrieb Georg Friedrich Hegel. Er meinte damit, dass selbst die Philosophie erst Erklärungen liefern kann, wenn die zu deutenden Geschehnisse bereits Geschichte, also längst vergangen sind. Mit ewig gültigen Erkenntnissen hält sich Mantel aber wohlweislich zurück. Sie schlüpft mit begeisternder Besessenheit in ihre handelnden Figuren hinein. «Veranschaulichung und Erklärung» sind die beiden Antipoden, zwischen denen sie sich bewegt.
Mehr noch als in den wahrlich finsteren Zeiten, in denen Cromwell lebte, faszinieren uns bis heute Veranschaulichung und Erklärung in der Französischen Revolution. Vor allem natürlich die Frage, wie es möglich war, dass der erste moderne Versuch, nicht nur eine Monarchie und Adelsherrschaft hinwegzufegen, sondern darauf eine auf Menschenrechte für alle, Vernunft und Freiheit aufgebaute Gesellschaft zu errichten, in einer Schreckensherrschaft, in der Terreur vorläufig endete. Wie der als Autor der französischen Erklärung der Menschenrechte angesehene Saint-Just sich in einen Todesengel verwandelte, der zusammen mit Robespierre auf dem Schafott endete. Nachdem Robespierre, beeinflusst von Saint-Just, seine «Brüder» Danton und Desmoulins darauf geopfert hatte. Nachdem sich das Streben nach dem Guten und Gerechten in ein Gemetzel verwandelt hatte.
Dass sich die ehemals Herrschenden zur Wehr setzen, begleitet jede Revolution. In Frankreich verbündete sich der Adel mit den europäischen Monarchien zum bewaffneten Widerstand, in Russland Adel und Grossgrundbesitzer mit den imperialistischen Staaten. Natürlich tobt bis heute ein ideologischer Kampf darum, ob die Terreur Revolutionen immanent ist – oder eine durch den äusseren Druck bewirkte Deformation.
Viel Veranschaulichung liefert Mantel im Aufeinanderprallen ihrer drei Protagonisten. Wie sie von Betrachtern zu Handelnden werden, mitgerissen von den Ereignissen und selbst mitreissend. Worte werden zur Guillotine, ein falsches Wort führt aufs Schafott. Schlimmer noch: «Es gibt Phasen in der Revolution, in denen alleine schon am Leben zu sein ein Verbrechen darstellt, und die Menschen müssen ihre Köpfe herzugeben wissen, wenn das Volk sie fordert», sagt Robespierre zu Desmoulins. Denn schnell ging es nicht mehr um eine bessere Welt, sondern um die beste aller Welten; Robespierre «hatte eine Republik der Gerechtigkeit, der Gemeinschaft, der Selbstaufopferung im Sinn, er sah ein freies Volk vor sich».
Desmoulins nannte sich selbst den «procureur de la lanterne», Danton duldete als Justizminister die Septembermassaker des Jahres 1792, zusammen mit Robespierre formte und lenkte er den Wohlfahrtsausschuss, das eigentliche Machtzentrum der Revolution, der Schreckensherrschaft. Alle drei sahen sich auf ihre Art als Exekutoren des Volkswillens. Als diejenigen, die zur Beförderung der guten Sache, zur Verteidigung der Revolution auch Schlechtes tun müssen. Gegen ihre eigenen Prinzipien verstossen, im Namen eines absoluten Prinzips. Wer sich ihnen in den Weg stellt, verrät die Revolution, schlimmer noch, die «Republik der Gerechtigkeit». Auch Namen wie Danton oder Desmoulins schützen vor diesem Verdacht nicht, nicht mal der Name Robespierre oder Saint-Just.
Wir wissen, wie es ausging, aber wir wissen nicht, wie es dazu kam, sagt Mantel. Wir wollen jedoch Ordnung in die Dinge bringen. Aus der Vergangenheit lernen, um die Gegenwart zu begreifen und die Zukunft zu gestalten. Sonst wäre die Geschichte ja nur ein riesiger Ozean, in der wie Trümmerstücke einzelne Ereignisse zusammenhangslos herumschwimmen. Die Instrumente fürs Einordnen sollte uns die Geschichtswissenschaft liefern. Nur ist sie genauso wenig eine exakte Naturwissenschaft wie die sogenannte Finanzwissenschaft. Also bastelt sich letztlich jeder, manche mit kleinem Besteck, andere mit grosser Kelle, sein Geschichtsbild zusammen. Manche meinen, alle Antworten zu haben. Andere interessieren sich mehr für Fragen.
In diesen ewigen Zwiespalt – hole ich nur aus der Geschichte heraus, was ich vorher in sie hineingetragen habe, oder kann ich den Anspruch erheben, darzustellen, wie es war – stürzt sich Mantel mit einem originellen Ansatz: Sie schreibt, wie es sehr wohl gewesen sein könnte. Dass sie eine Geschichte schreibt – und nicht die Geschichte – macht ihre Romane über längst vergangene Geschehnisse, über längst zu Staub zerfallene Menschen zu einem Erlebnis. Liefert Erklärungen, aber keine Gesetzmässigkeiten, keine auf heute übertragbare Prinzipien. Man besucht mit Danton Robespierre in seiner kargen Kammer. Man steht vor Desmoulins und begreift, wäre der wackelige Stuhl, auf dem er während seiner Rede stand, umgefallen, hätte es vielleicht den Sturm auf die Bastille nicht gegeben. Man zittert an der Seite von Cromwell, während er sich am Hofe Heinrichs VIII seiner Haut erwehrt, ein Wolf unter Wölfen.
Ein Vierteljahrtausend später werden auch in der Französischen Revolution die Brüder zu Wölfen, wollen Brüderlichkeit durch Schrecklichkeit erschaffen. Aber Mantel hütet sich, mehr als Veranschaulichung und Erklärung zu liefern. Wohl deswegen bleiben auch die Figuren Saint-Just und Marat seltsam blass, obwohl sie die ideologischen Treiber der Geschehnisse waren. Immerhin plant sie, einen weiteren Roman über Marat zu schreiben, man darf gespannt sein.
Man legt nach der Lektüre «Brüder» aus der Hand und weiss, dass Mantel dieser Roman mit seinem fast unüberschaubaren Personal und seinen 1100 Seiten etwas zu lang geraten ist. Da hatte sie noch nicht völlig die meisterhafte Souveränität von «Wölfe» und «Falken» erreicht. Aber man bedauert gleichzeitig zutiefst, dass die Geschichte so endet, wie sie eben endete. Indem Danton das Schafott besteigt und dem Scharfrichter Sanson zuruft: «Zeigen Sie den Leuten meinen Kopf. Es ist die Mühe wert.» An dieses historische Ereignis schliesst Mantel noch die literarische Erfindung an, wie sich Robespierre in Vorahnung seines eigenen Todes an seine Mutter erinnert, die klöppelte, «unter ihren Fingern das luftige Muster, es fliegt davon, ins Nichts.» Und kontrastiert das mit einer historische Meldung aus der «Times» vom 8. April 1794, in der das Ende von Danton und Desmoulins kommentiert wird. Ersterer starb, weil es unausweichlich war, dass der «Geschicktere der beiden», also Robespierre, «einen Weg gefunden haben würde, seinen Rivalen zu beseitigen». Der «Times»-Journalist fährt fort: «Wir begreifen nicht, warum Camille Desmoulins, der von Robespierre so unverhohlen protegiert wurde, im Triumph dieses Diktators zermahlen wurde.»
Ist also das menschliche Streben nach dem Besseren nur vergebliche Mühe? Können auch unlautere Motive das Gute befördern? Muss auch das edelste Motiv, es besser zu wissen und die Massen deshalb zu ihrem Glück zwingen dürfen, in Diktatur und Massenmord führen? Der Leser lernt bei der Lektüre, dass es wohl besser ist, in der Geschichte und in seiner eigenen Gegenwart Betrachter zu bleiben, nicht zum Handelnden zu werden. Wenn man das Privileg lebt, nicht dazu gezwungen zu sein. Worte wirken, aber wer will schon ernsthaft Verantwortung für die Wirkung übernehmen? Ich für meinen Teil halte Diagnosen für bekömmlicher als Therapievorschläge. Das unterscheidet mich von vielen Wortführern und Weltverbesserern.
Man legt nach der Lektüre das Buch «Brüder» mit Bedauern aus der Hand, weil es noch viel länger sein sollte. Denn selten ist man näher am Begreifen der Geschichte und auch am Nichtbegreifen, wie wenn man Mantel liest. Sich selber sein im Anderssein, näher kann man als Leser diesem Satz von Hegel wohl nicht kommen.
Hilary Mantel:
- Wölfe. 768 Seiten, 2010 auf Deutsch erschienen
- Falken. 480 Seiten, 2013 auf Deutsch erschienen
- Brüder. 1100 Seiten, 2012 auf Deutsch erschienen
Alle im DuMont Buchverlag.