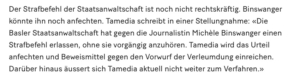Weltmeisterschaft der Heuchler
Es sollte eine olympische Disziplin werden. Pflicht, Kür, Medaille im Heuchel-Wettkampf. Verliehen wird ein Tartuffe in Gold, Silber oder Bronze.
Ich sage Afghanistan. Was sagst du? Die Flüchtlingsorganisation der UNO sagt: «UNHCR ruft aufgrund der humanitären Krise in Afghanistan zu einem dauerhaften Waffenstillstand und einer Verhandlungslösung im Interesse des afghanischen Volkes auf.»
Was sagt die UNICEF, die Kinderhilfsorganisation der UNO? «Wir fordern die Taliban und andere Parteien auf, dafür zu sorgen, dass UNICEF und unsere humanitären Partner sicheren, rechtzeitigen und ungehinderten Zugang haben, um Kinder in Not zu erreichen, wo immer sie sind. Darüber hinaus müssen alle humanitären Akteure die Möglichkeit haben, nach den humanitären Grundsätzen der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit zu handeln.»
Was sagt CH Media? «Deutscher Afghanistan-Veteran: «Die Menschen fürchten die Rache der Taliban – sie haben Todesängste»»
Was meldet der «Tages-Anzeiger»? «James Dobbins war der erste US-Botschafter in Afghanistan nach der Invasion von 2001 und Berater von Bush und Obama. Er sagt unter Tränen: Ich trage eine Verantwortung.»»
Was sagen die USA über das Schicksal der bereits Ausgeflogenen, die in Doha zwischengelagert werden? «Man sei sich der «schrecklichen hygienischen Zustände in Katar» bewusst, die dort geherrscht hätten, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Man habe bereits daran gearbeitet, sie zu verbessern», berichtet «20 Minuten».
Die St. Galler Stadträtin Sonja Lüthi:
«Ich bin persönlich – wie auch der gesamte Stadtrat – tief betroffen von den erschütternden Bildern, die uns aus Afghanistanerreichen.»
Auch Balthasar Glättli, Präsident der «Grünen», ist aufgewacht und will das Feld nicht Afghanistan-Kreische Fabian Molina und seiner SP überlassen: «Der Bundesrat zeigt sein kaltes Herz: 230 Personen aufzunehmen, während Millionen Menschen in Gefahr sind, ist ein Hohn. Wir GRÜNE fordern die Aufnahme von mindestens 10’000 Menschen, die besonders bedroht sind.»

Hauptsache gut im Bild: Balthasar Glättli.
Das sieht die Schweizerische Flüchtlingshilfe auch so:
«Afghanistan: Die Schweiz muss mehr leisten für den Schutz der Flüchtlinge»
Neben diesem Maulheldentum, was passiert denn konkret? In Deutschland versucht ein EU-Abgeordneter der Grünen, einen Charterflug nach Kabul zu organisieren und sammelt dafür Spenden ein. Leider hatte der gleiche Erik Marquardt schon rund 300’000 Euro für das Chartern eines Bootes zur Seenotrettung im Mittelmeer gesammelt. Zu einem Einsatz des Schiffes kam es nicht …
Aber Marquardt unterscheidet sich von den fordernden Heuchlern immerhin dadurch, dass er etwas Konkretes auf die Beine stellen will. Er antwortet allerdings nicht auf journalistische Anfragen; man sei zu sehr mit der Organisation des Charterflugs beschäftigt. Mangels anderer Nachrichten ist es wohl eher ausgeschlossen, dass der vor dem 31. August noch stattfinden wird.
Reine Heuchelei, absurde Forderungen
Alles Betroffenheitsgesülze ist reine Heuchelei. Konkrete Hilfe ist gar nicht so einfach. Vielleicht sind da alle unter talibanartigen Zuständen bei Tamedia leidende Frauen konsequent, wenn sie zum Thema Afghanistan und Frauen einfach schweigen. Betrifft ja nicht ihren eigenen Bauchnabel, und der interessiert sie halt schon am meisten.
Es ist schwierig, konkret etwas zu tun. Angesichts all dieser hohlen Forderungen, Solidaritätsadressen, dem mehr oder minder lyrischen Ausdruck der Erschütterung kann man nur festhalten: das ist alles so widerlich, dass es eine neue Wettkampfdisziplin geben sollte. Wir schlagen den Namen «Radfahrer-Dreisprung» vor. Gemessen werden die Sprungweite, die Haltung dabei und die Eleganz der Landung.
Dabei gibt es eine Pflicht- und ein Kürnote. Pflicht bewertet die obligatorischen Sprünge, Kür besondere Einlagen dabei.

Gehupft wie gesprungen: leiden und fordern.
Der erste Sprung besteht in der möglichst eindrücklichen Darstellung der eigenen Betroffenheit. Der zweite ist das Anprangern des allgemeinen Versagens, ausgenommen das eigene. Der dritte Sprung besteht schliesslich aus einem Forderungskatalog.
Kürnoten gibt es für Zusatzsaltos, Schrauben und besonders beeindruckende Luftblasen beim Springen. In der Schweiz sind zurzeit Cédric Wermuth, Fabian Molina und neu Balthasar Glättli in den Medaillenrängen. Aber eine endgültige Bewertung steht noch aus; alle Sprünge bis zum 31. August zählen für die Wertung.


Von links nach links: Wermuth und Molina sowie Molina.
Der Wettbewerb steht auch für Frauen, Transgender oder Non-Binäre offen, obwohl wir hier noch keine beeindruckenden Leistungen gesehen haben; vielleicht mit Ausnahme von Sibel Arslan oder Tamara Funiciello. Aber beide haben noch keinen gültigen Versuch hingelegt, nur unkoordinierte Kurzsprünge.


Wenn du für alle kämpfst, kämpfst du für niemanden …
Nur meckern und polemisieren?
Natürlich ist die Frage erlaubt: Was macht dann ZACKBUM eigentlich? Wir haben gespendet, obwohl wir nicht sehr optimistisch sind. Wir setzen uns zudem für den in die Schweiz geflüchteten ehemaligen BBC-Bürochef in Kabul ein, der verzweifelt versucht, seine Familie aus Afghanistan herauszukriegen. Es ist bekannt, dass die fundamentalistischen Irren hinter ihrer freundlichen Fassade für blöde westliche Medien schon längst dabei sind, Listen abzuarbeiten, auf denen auch kritische Journalisten oder deren Familienangehörige stehen.
Dafür halten wir uns mit Betroffenheitsgesülze zurück, stellen keine absurden Forderungen auf und schimpfen auch nicht über das Versagen des Westens in Afghanistan, nachdem wir jahrelang nichts zu diesem Thema sagten. Uns hält das, im Gegensatz zu den Berufsheuchlern, etwas von Verurteilungen ab.