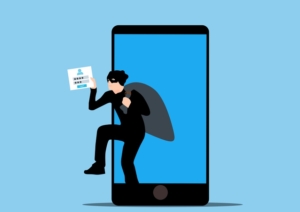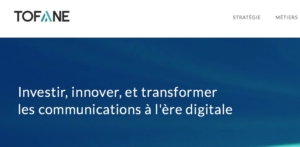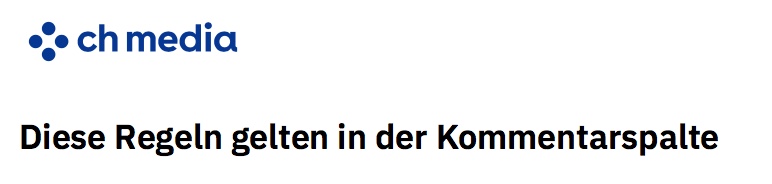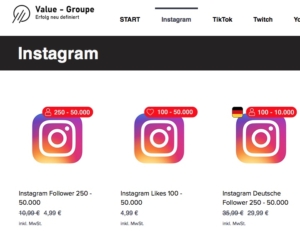Das erste Opfer des Kriegs
Nein, das ist nicht die Wahrheit. Weil es immer nur Wahrheiten gibt.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Das erste Opfer eines Kriegs ist die Bereitschaft zur Nachdenklichkeit. Ist der Verlust der Einsicht, dass niemand die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Stattdessen ist der Wettbewerb eröffnet: wer formuliert mit möglichst wenig Kenntnissen eine möglichst starke Meinung?
Dabei gibt es bislang nur eine unumstössliche Tatsache: Es ist ein durch nichts zu rechtfertigender Angriffskrieg. Es ist keine präventive Verteidigung. Es ist keine Aktion zur Entnazifizierung und auch nicht zur Verhinderung eines Genozids.
Sonst aber ist es alles, was Grossmächte halt ab und an so tun. Was die USA samt ihren westlichen Verbündeten in Vietnam, in Afghanistan, im Irak und in den Gebieten des sogenannten arabischen Frühlings taten und tun. Es ist das, was die europäsichen Verbündeten und die NATO insgesamt in Jugoslawien taten. Einen völkerrechtswidrigen Krieg zu führen nämlich, der nicht zuletzt in der völlig illegalen Abspaltung des Kosovo von Serbien endete, begleitet von Massakern allerorten.
Das macht die serbische Regierung nicht zu einer Versammlung von Chorknaben, genauso wenig wie die ukrainische. Noch 2014 gab es die Beteiligung von Neofaschisten an der ukrainischen Regierung, bis heute spielt das Regiment Asow, dem ukrainischen Innenministerium unterstellt und voller bewaffneter Neofaschisten, eine unrühmliche Rolle.
Die armen, uninformierten Russen
Weit verbreitet ist das Bedauern, dass die russische Bevölkerung leider nur von staatlich gelenkten Medien beschallt werde, was natürlich die Zustimmungswerte für Diktator Putin erkläre. Das ist ein typisches Beispiel für fehlende Fähigkeit zur Differenzierung.
Es ist grundsätzlich richtig, dass beispielsweise der auch auf Deutsch erhältliche Sender «Russia Today» die Karikatur eines nach journalistischen Prinzipien arbeitenden Newsverarbeiters ist. Die russischen TV-Programme, die grossen russischen Zeitungen, unbrauchbar. Aber: dank Internet kann sich jeder Russe, etwas Gelenkigkeit vorausgesetzt, beliebig informieren, aus allen erhältlichen Nachrichtenquellen der Welt.
Was die Schweizer Mainstream-Medien bieten, unterscheidet sich nicht gross von der disqualifizierenden Berichterstattung über die Pandemie. Repetitive Schwarzweiss-Malerei, oberflächliches Gehampel, verzweifelte Suche nach «Experten», die die Angst vor einem Atomkrieg zerstreuen sollen.
Jeder Schweizer kann sich aus allen alternativen Nachrichtenquellen der Welt bedienen. Wer sich die Zeit nehmen will, ein wenig Gegengift gegen den Mainstream aufzunehmen, dem sei ein schon älterer Artikel empfohlen.
Man bedauert, dass viele dieser warnenden Stimmen für immer verstummt sind. Unter den hier aufgeführten nur ein Zitat:
«Wir, die Unterzeichner, glauben, dass eine weitere NATO-Osterweiterung die Sicherheit unserer Alliierten gefährden und die Stabilität in Europa erschüttern könnte. Es besteht für die europäischen Nachbarn keine Bedrohung durch Russland.»
Welcher russlandhörige Kurzdenker hat denn das formuliert? Nun, es handelte sich um niemand geringeren als den für den Vietnamkrieg verantwortlichen ehemaligen US-Verteidigungsminister Robert McNamara.
Oder ein Zitat des Kriegsverbrechers und Kältesten aller kalten Krieger, Henry Kissinger: «Um zu überleben und sich zu entwickeln, darf die Ukraine Niemandes Vorposten sein. Vielmehr sollte sie eine Brücke zwischen beiden Seiten darstellen. … Dabei sollten wir uns um Versöhnung bemühen, und nicht um eine Dominanz einer der Fraktionen. … Die Dämonisierung von Wladimir Putin ist keine Politik. Sie ist ein Alibi für die Abwesenheit von Politik.»
Und der Elder Statesman Helmut Schmidt liess ebenfalls keinen Zweifel an seiner Meinung über eine mögliche Aufnahme der Ukraine in die EU und die NATO: «Das ist Größenwahn, wir haben dort nichts zu suchen.»
Jeder kann sich irren. Nur der «Experte» nicht
Natürlich können sich auch alle diese Herren irren. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass in den Mainstreammedien, in der sogenannten freien Presse des Westens, in den von drei Medienclans beherrschten Tageszeitungen der Schweiz keine einzige Stimme Gehör findet, die sich um etwas Differenzierung bemüht.
Stattdessen geht die verzweifelte Suche nach Russland-Erklärern weiter. Genauer nach Figuren, die wie gewünscht in den Echo-Chor der Putin-Verdammer einstimmen. Neuster Versuch von «Blick TV»: Ulrich Schmid. Der HSG-Professor fantasiert von einem möglichen Zusammenbruch des Regimes und analysiert mit unglaublichen prognostischen Fähigkeiten: «Ich könnte mir vorstellen, dass die Einschüchterung massiver wird.»

Der Mann mit der Glaskugel: Zukunftsseher Ulrich Schmid.
Für solche Erkenntnisse sind wir echt dankbar, denn dafür muss man Slawistik studiert haben.