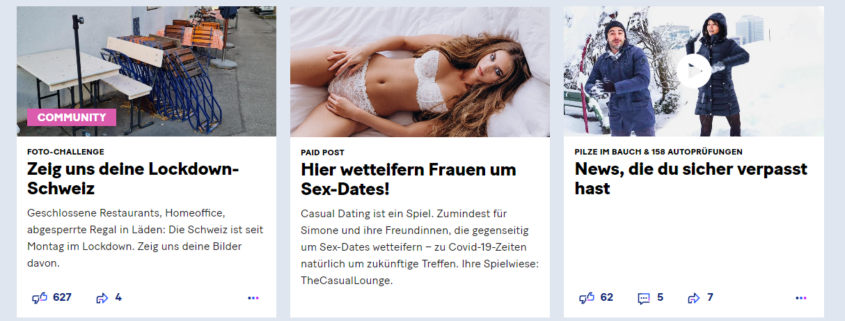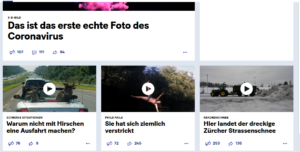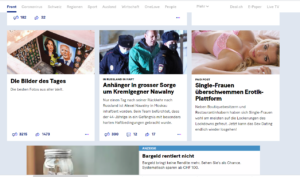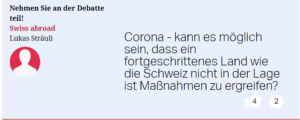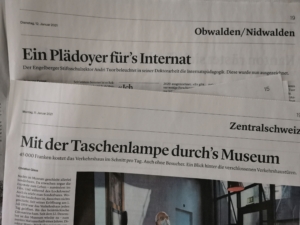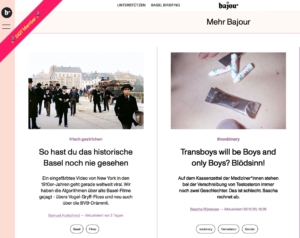Blasen aus dem Mediensumpf.
Werfen wir zunächst einen Blick auf ein gutes Stück Qualitätsjournalismus aus dem Hause Tamedia:

Interessen der deutschen Sprache in Untergewichtung.
Da muss man wie beim Schneeräumen geordnet vorgehen, um die Fehlersammlung vollständig wegzuräumen.
Fangen wir mit dem Einfachen an: Saudi-Arabien schreibt man so. Macht nix, ist ja auch irgend so ein Morgenland, und Pilatus ist im Fall richtig geschrieben.
Das gilt dann aber nicht für «Heraushaltung». Man ahnt zwar, was damit gemeint ist, aber leider existiert das Wort nicht. Obwohl es eine Lieblingsmarotte des Beamtendeutschs ist, alles, was nicht schnell genug davonläuft, zu substantivieren.
War’s das? Nein, bei so vielen Buchstaben kann man doch auch inhaltliche Fehler nicht vermeiden: «Welche Interessen sind höher zu gewichten …, oder Arbeitsplätze und der Technologiestandort Schweiz?» Da möchte man gerne wissen, welche Interessen denn Arbeitsplätze artikulieren, vom Technologiestandort ganz zu schweigen. Und durch die gewählte Form des Satzes kann der Hersteller vermeiden, die entscheidende Auskunft zu geben: wer gewichtet denn diese Interessen? Das Bundesverwaltungsgericht? Der Autor? Wir?
Man muss schon sagen: So wenig Wörter, so viele Fehler. Da weiss man doch wieder, wieso sich Geldausgeben für eine Zeitung lohnt.
Ein Wirtschaftschef im roten Bereich
Die Rechtschreibung hat hingegen Peter Burkhardt (oder der Korrektor der SonntagsZeitung, wenn es ihn noch gibt) im Griff. Der Wirtschaftschef des Hauses Tamedia ist normalerweise ein konzilianter Mensch, eher auf Ausgleich statt Konflikt bedacht.
Aber tiefe Wasser schlagen hohe Wellen, wenn sie mal aufgewühlt sind. So verwandelt Burkhardt das Editorial der aktuellen SoZ, den Leitartikel, in einen Leidartikel. In eine Schimpfkanonade ungekannten Ausmasses. Den ersten Pflock schlägt er bereits im Titel ein: «Die Schweiz – ein Opfer rechtsbürgerlicher Ideologie».
Solche Töne ist man sonst von der WoZ gewohnt. Auch in der Fortsetzung wirft Burkhardt nicht mit Schneebällen, sondern setzt seinen revolutionären Durchmarsch fort, es wird scharf geschossen. Mit einer klassischen Nummer. Zuerst lobt er Finanzminister Ueli Maurer. Der habe «vieles richtig gemacht», die Staatsfinanzen in Ordnung gehalten, bravo. Nur: «vor der Corona-Krise.»
Seither gilt: «Jetzt, in der Not, macht Maurer vieles falsch.» Warum? Weil Burkhardt etwas hat, was Maurer fehlt: «der Blick fürs grosse Ganze.» Was übersieht Maurer da? Bei der Bekämpfung der Pandemie brauche es «scharfe Massnahmen», weiss Pandemiologe B. Plus «grosszügige, rasche Geldspritzen», ergänzt der Wirtschaftskenner.
Denn, so die glasklare Logik, zunächst können wir uns das leisten. Geringe Staatsverschuldung, Negativzinsen, eine Pleitewelle «wegen unterlassener Hilfeleistung» sei dann im Fall noch schlimmer.
Nach Anlauf im Volldampf-Modus
Soweit aufgewärmter, kalter Kaffee von vorgestern. Aber bis hierher hat Burkhardt nur seine Betriebstemperatur erreicht und den Druck im Kessel erhöht. Nun lässt er aber richtig Dampf ab: «Die Schweiz ist in Geiselhaft rechtsbürgerlicher Ideologien.» Ausgerechnet die «Wirtschaftsparteien» FDP und SVP «gefährden damit die Wirtschaft». Das führt Burkhardt dann zu Volldampf am Schluss: «Wer behauptet, unser Land könne sich konsequente Massnahmen nicht leisten, setzt nicht nur den Wohlstand aufs Spiel – sondern nimmt letztlich Tote in Kauf.»
Aber hallo, FDP und SVP gehen über Leichen? Rechtsbürgerliche Ideologie will die Wirtschaft abwürgen, nimmt auch tote Eidgenossen hin? FDP und SVP als Totengräber des Kapitalismus? Wahnsinn. Wir sind allerdings verwirrt. Lautete der Vorwurf bislang nicht, dass wirtschaftsfreundliche Parteien Geld und Wirtschaft höher gewichten als Leben und Gesundheit?
Fehlt Maurer wirklich der Blick fürs grosse Ganze, wenn er – als einziger Bundesrat – darauf hinweist, dass hier Entscheidungen übers Knie gebrochen werden, die Auswirkungen für die nächsten 15 Jahre haben?
Money for free – jetzt auch von Wirtschaftschefs gefordert
Ist Burkhardt in seinem Zorn wirklich entfallen, dass Schuldenmachen, vor allem für Staaten, tatsächlich kinderleicht ist, dass aber konsumiertes Geld einfach weg ist, keine Wertschöpfung schafft, einfach Ersatz ist für vorher betriebene Produktion? Meint Wirtschaftschef Burkhardt wirklich, man könne eine Schraubenfabrik ins Koma versetzen, die Belegschaft nach Hause schicken, all das mit Hilfsgeld zuschütten, und das sei problemlos und zukunftsträchtig?
Money for free, das ist der uralte, feuchte Traum der Etatisten, der Gläubiger eines allmächtigen Staats mit tiefen Taschen. Das ist diese «kann sich doch die reiche Schweiz leisten»-Haltung. Dass so etwas von SP-Genossen propagiert wird, deren einziger Kontakt zur Wertschöpfung, zur Wirtschaft darin besteht, vom warmgefurzten Funktionärssessel aus gute Ratschläge zu erteilen, ist zumindest logisch.
Aber der Wirtschaftschef eines der beiden Duopolmedien der Schweiz? Fehlt nur noch, dass er eine Sondersolidaritätsabgabe von den Reichen fordert, denn die haben’s ja. Er hingegen hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Jedem sein eigener «Experte»
Was die «Weltwoche» mit ihren irgendwo ausgegrabenen «Experten» kann, die noch ein nettes Wort zu Trump sagen, kann der SoBli erst recht. Nachdem nun wirklich von allen alles über den Abgang Trumps gesagt wurde, es bis zum nächsten Höhepunkt, der Amtseinführung, noch etwas hin ist, was tun?
Glücklicherweise sind die USA gross genug, dass man immer einen Spezialisten für alles findet. SoBli proudly presents: Eric Ward. DEN Extremismus-Experten, den verdienstvollen Mitarbeiter einer Bürgerrechts-NGO. Mehr Informationen über ihn zu finden, ist etwas schwierig, er hat im Internet nur wenige Spuren hinterlassen. Aber was soll’s, der richtige Gesprächspartner für die Frage, wie’s denn mit Trumps Partei weitergehen soll. Ward als alter Hase weiss natürlich, dass es bei solchen Interviews vor allem um ein titelfähiges Quote geht, und das liefert er: «Der Bürgerkrieg in der Republikanischen Partei hat begonnen». Um das zu merken, muss man allerdings Extremismus-Experte sein.
Noch ein Experte für alles und noch viel mehr
Ein anderer Experte für eigentlich alles und noch mehr kommt trotz fortgeschrittenem Alter in geradezu jugendliche Lockerheit und wagt den Kolumnen-Titel: «Huaweia». Dann drischt Frank A. Meyer mit ungestümer Energie auf den chinesischen IT-Konzern Huawei ein. Wunderbar, muss mal gesagt sein. Kleines Problem: Er stützt sich dabei auf eine weitere Grossreportage der «Republik». Mal wieder 41’000 Buchstaben brauchte die Plattform, um im Verbund mit anderen grosse Schweinereien eines grossen Konzerns aufzudecken.

Leicht unverständliche Illustration: Screenshot «Republik».
Auch wunderbar. Nur: bislang ist die «Republik» mit solchen «Enthüllungen» regelmässig auf die Schnauze gefallen. Mit ihren Vorwürfen gegen die ETH Zürich, mit ihren Verleumdungen gegen den Kita-Betreiber Globegarden als jüngste Beispiele. Das liegt meistens daran, dass die «Republik» konsequent mit anonymen (oder «anonymisierten», wie sie zu sagen pflegt) Informanten arbeitet. Deren Motivation, der Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen sind für Redaktion und Leser nicht erkennbar. Da es sich fast immer um ehemalige Mitarbeiter handelt, muss ein weiteres Fragezeichen hinter ihre Wahrheitsliebe gesetzt werden.
Deshalb hat auch bei Globegarden eine externe und umfangreiche Untersuchung ergeben, dass kein einziger der Vorwürfe, die die «Republik» erhoben hatte, verifiziert werden konnte. Keiner, null, nada. Dass hingegen einige Vorwürfe nicht überprüft werden konnten, weil ausser der anonymen Aussage keine weiteren Angaben vorhanden waren.
Von wem möchte man gerne abgehört werden?
Das ist im Fall Huawei natürlich etwas anders. Ein Riesenkonzern aus China mit undurchsichtiger Besitzerstruktur, ihm wird Staatsnähe und mögliche Spionage oder Aushorchung im Dienst des chinesischen Regimes nachgesagt.
Die Betonung liegt auf nachgesagt; belastbare Beweise fehlen bis heute. In erster Linie schimpfen die USA über Huawei und verbieten ihm, als Mitbewerber bei IT-Projekten aufzutreten. Verständlich, denn Huawei ist vor allem bei 5G seinen Mitbewerbern meilenweit voraus. Er bietet die Infrastruktur stabiler, besser und billiger an als die US-Konzerne.
Für den Nutzer kann man es sicher so sehen: Ob seine Kommunikation von der NSA oder von China abgehört wird – oder von beiden –, kann ihm eigentlich egal sein.
Nun verwendet die «Republik» auch hier wieder ihr vermeintlich bewährtes Prinzip. Es gibt als Zeugen für das Innenleben von Huawei Joe, Sam und Ana. Richtig, die heissen nicht so, wollen auch nicht erkannt werden. Aber dienen als Kronzeugen der Kritik an Huawei. Plus «einen ehemaligen Mitarbeiter von Huawei treffen wir in London».
Das soll à la «Spiegel» Weltläufigkeit ausdrücken, Detailtreue: «Die kanadischen Beamten stecken Mengs Huawei-Telefon, ihr iPhone, ein roségoldenes iPad und ein rosafarbenes Macbook in Sicherheitstaschen, die jeden Versuch, sie aus der Ferne zu löschen, unmöglich machen.»
So beschreibt die «Republik» die Verhaftung der Finanzchefin von Huawei, der Tochter des inzwischen milliardenschweren Firmengründers in Kanada. Im Gegensatz zu Relotius beim «Spiegel» räumt die «Republik» immerhin ein, das von «Wired» abgeschrieben zu haben. Dann muss es ja stimmen.
Garniert mit dem üblichen «Republik»-Gedöns
Garniert werden diese anonymen Beschuldigungen mit dem üblichen «Republik»-Gemüse. Anschuldigungen, Dementis, Vorwürfe, von Huawei bestritten. Aber das gibt natürlich den Geräuschteppich für die These: Huawei ist ein ganz übler Ausbeuter. Ein wunderbares Beispiel: Dem «Recherche-Netzwerk» ist eine Excel-Tabelle in die Hände gefallen, in der die Arbeitszeiten von europäischen Mitarbeitern eingetragen sind. Könne man nicht meckern, räumt die «Republik» ein, auf dem Papier sehe alles ordentlich und gesetzeskonform aus.
Wer ahnt das Aber? Natürlich, anonyme Ex-Mitarbeiter behaupten, in Wirklichkeit werden die Arbeitszeiten nicht eingehalten, besonders, wenn ein Grossprojekt vor dem Abschluss stünde. Dann würden sogar, unglaublich, zusätzliche Kräfte aus China eingeflogen. Das kann vielleicht der Grund dafür sein, dass Huawei im Vergleich zu seinen Mitbewerbern als ausnehmend pünktlich gilt. Wer schon einmal mit gröberen IT-Arbeiten zu tun hatte, weiss, was das wert ist.
Leider ist die «Republik» wie Antifalten-Creme
Nebenbei: Militärischer Jargon in einer Firma, die von einem Militär gegründet wurde, die eine oder andere Schweinerei gegenüber fast 200’000 Mitarbeitern: unbestritten, üblich; mit drei anonymen Zeugen und viel Geraune nicht im Ansatz als systemisch bewiesen.
Es ist Meyer zu gönnen, dass seine Lektüre der «Republik» verjüngend auf ihn wirkt. Nur: auf den Wahrheitsgehalt von deren Storys sollte er sich nicht verlassen.