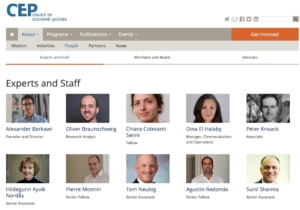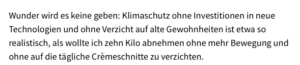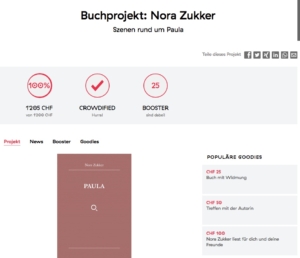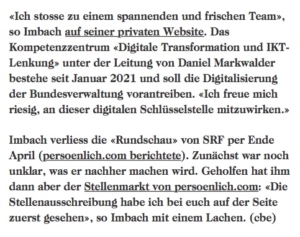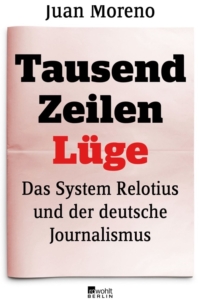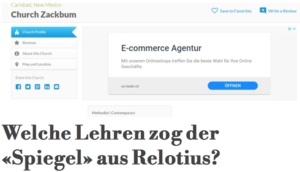Ein Wappler ist die neue Messeinheit für einen TV-Flop. Wenn man alles zerredet, nennt man das inzwischen wappeln. Oben ein Blick in den SRF-Newsroom.
Eric Gujer ist Chefredaktor der NZZ. Daher ist er von Natur aus ein Mann mit Mass und Mitte. Vielleicht nicht in der Gestaltung seiner Ferien, aber sonst. Wie Politiker überlegt er sich zudem lange, ob er unserem Staatsfunk, Pardon, dem gebührenfinanzierten Service Public, an den Karren fahren will.
«Die SRG ist zur PR-Agentur des Bundesrates mutiert»,
schimpft Gujer über die unkritische Corona-Berichterstattung. «Saftladen», so kommentiert der normalerweise christlich milde Parteipräsident der «Mitte», Gerhard Pfister. Auch er weiss, dass damit seine Chancen, die Birne vor eine Kamera halten zu können, nicht gerade steigen. Das ist aber für einen Politiker existenziell wichtig.
«Play Suisse» (wer’s nicht kennt: ein neues Streaming-Angebot mit wackeligem Datenschutz), Sendungen mit nicht messbarer Einschaltquote, Streichungen von Sendungen mit messbarer Einschaltquote. Schawinski raus, konfliktiv, aber mit Herzblut der Meister der Talkshows. Gredig rein, sympathisch, aber so spannend wie der Farbe beim Trocknen zuschauen.
Sparmassnahmen, Entlassungen, Verlust, ein Newsroom, der in Konkurrenz mit dem Berliner Flughafen steht (nur kleiner und billiger, der Neubau-Flop kostet die SRG schlappe 400’000 Franken im Monat). Kurzarbeit unten, der SRG-Generaldirektor verdient stolze 533’000 Franken, trotz sehr überschaubarer Performance. Nathalie Wappler, SRG-Direktorin, kassiert 450’000 Franken, Liga Bundesrat, nur mit im Vergleich mikroskopischem Verantwortungsbereich.

Berliner Flughafen von aussen. SRF-Newsroom von innen.
Vor ziemlich genau 6 Jahren machten 3694 Stimmen den Unterschied aus: die geräteunabhängige Zwangsgebühr wurde so knapp wie noch nie eine Vorlage angenommen. Die einen, wie Susanne Wille, steigen ohne grossen Leistungsausweis in die Geschäftsleitung auf und verdienen so auch nette 390’000 Franken im Jahr. Mal Hand aufs Herz, würde der Kultur oder SRF etwas fehlen, wenn Wille ihren Gatten Franz Fischlin nach dessen «Tageschau» als Hausfrau und Mutter am heimischen Herd erwarten würde?
Rare Erfolgsmeldungen bei SRF
Sandro Brotz rotzt auf den sozialen Plattformen einen raus gegen Coronamassnahmen-Kritiker, diese «Flacherdler». Als er damit überraschungsfrei einen Shitstorm auslöst, zieht er sich beleidigt aus den Social Media zurück – kurzzeitig. Eigentlich müsste auch er den neuen Leitfaden, die «Publizistischen Leitlinien», auf Mann tragen. Auf den neugebackenen 100 Seiten (!) heisst es, «wir stehen für die Werte und die Haltung von SRF» auch «in unseren privaten Posts auf Social Media ein». Scheiss drauf, sagt Brotz zu diesem Wertediktat.
Das ZDF kommt übrigens mit 4 Seiten Leitlinien aus, aber immerhin: mit dieser Fleissarbeit haben die jeweils zwei SRF-Mitarbeiter, die hinter einem tatsächlich medial Tätigen stehen, bewiesen, dass sie nicht nur scheintot in ihren Büros schnarchen.
Aber damit hat es sich auch schon mit den Erfolgsmeldungen, seit das «Fallbeil vom Leutschenbach» ihren Job angetreten hat. Gerade bei der gross angekündigten Digitalisierung harzt es ungemein, und mit gelegentlich sehr knackigen Aussagen nach innen und aussen macht sich Wappler zudem ungemein beliebt. So beliebt, dass die SVP inzwischen ergrimmt wieder einen Anlauf nehmen will, der SRG den Geldhahn wenn nicht ab, dann wenigstens zuzudrehen.
In dieser Lage, in der gerade bei einem Medienunternehmen Kommunikation ungemein wichtig ist, liess sich Nathalie Wappler auf ein Interview mit Edith Hollenstein von persoenlich.com ein

Würden Sie dieser Frau Ihre Karriere anvertrauen?
Hier zeigt die SRF-Chefin, wie man jeden beliebigen Wappler wappeln kann. Hollenstein ist nicht gerade als gnadenlose Interviewerin bekannt, aber die eine oder andere kritische Frage musste sie natürlich – angesichts von Zustand und Stimmung bei SRF – anbringen. Das führte dann zu folgenden Höhepunkten beim Wappeln.
Die Antworten glitschen weg wie Öl
Hollenstein steigt mutig mit der Witzfrage ein, was eigentlich der Unterschied zwischen dem Berliner Flughafen und dem SRF-Newsroom sei. Die gewappelte Antwort: «Unser Newsroom ist von aussen gesehen fertig – eine Baustelle ist er nicht mehr.» Von aussen gesehen war das der Flughafen auch – jahrelang.
«Zwar sind die Studios und der «Master Control Room» noch nicht in Betrieb, doch ich bin zuversichtlich, dass Ende 2021 oder sonst im Frühling 2022 das ganze Gebäude», und wappel, wappel. Kostet eine Stange Geld, 400’000 jeden Monat? «Es handelt sich nicht um externe Kosten, die ich aus einer unserer Kassen begleichen muss, sondern um interne Leistungen.»
Aber Kosten sind doch Kosten? Schon, aber: «Zentral ist für mich, dass die Sicherheit der Systeme gewährleistet ist.» Das ist wappeln mit Sternchen und Auszeichnung. Sparen, Unzufriedenheit? «Ich verstehe, dass das eine belastende Situation ist für unsere Mitarbeitenden.»
Die könnten sich aber darauf verlassen, dass «wir so wenige Kündigungen aussprechen, wie es irgendwie geht». Ungemein beruhigend, andere Arbeitgeber würden sich bemühen, so viele Kündigungen wie möglich auszusprechen. Da können die SRF-Medienschaffenden froh sein, eine Wappler zu haben.
Freiwllige oder unfreiwillige Abgänge von Aushängeschildern?
«Selbst wenn mich jeder Abgang schmerzt, finde ich diese Fluktuation gut. Denn sie nützt der Medienlandschaft Schweiz.»
Das ist auch bekannt als der Doppelwappler mit extra Pommes. Was meint Wappler hingegen zur neusten Drohung der SVP? «Unsere Unabhängigkeit ist unser wertvollstes Gut. Sie ist nicht verhandelbar.»
Dann noch die Salärfrage …
Oooch, muss da die SVP sagen, schade, dabei wollten wir genau die verhandeln. Nun spricht Hollenstein gegen Schluss noch die turmhohen Gehälter der Chefetage an, ob es angesichts Verlust, Kündigungen und Einsparungen nicht ein Signal gewesen wäre, auch nur symbolisch auf einen Teil des üppigen Salärs zu verzichten?
«Wie soll ich das jetzt sagen? (überlegt). Die SRG zahlt keinen Bonus, es handelt sich um eine variable Lohnkomponente. Deshalb kann man das nicht miteinander vergleichen.» Als Hollenstein insistiert, bei den SBB habe es solchen Lohnverzicht gegeben, wappelt sich Wappler mit dem üblichen Argumentationsbesteckt durch: Vergleich, unteres Drittel, absolut gesehen ein hoher Betrag, viel verständnis für Emotionalität.
Hollenstein gibt nicht auf, Wappler natürlich auch nicht: «Ich möchte meinen Lohn nicht öffentlich machen, denn das wäre meinen Kollegen in der SRG-Geschäftsleitung gegenüber nicht fair. … Wenn man betrachtet, dass ich Direktorin bin eines Betriebs mit 3000 Mitarbeitenden,
ist mein Lohn im Vergleich zu bundesnahen Betrieben aus meiner Sicht gerechtfertigt.»
Dass Lohn vielleicht auch entfernt etwas mit Leistung zu tun haben könnte, auf diese abstruse Idee kommt Wappler als Staatsangestellte natürlich nicht. Wie sieht’s insgesamt so aus? «Wir sind also sehr gut auf Kurs.»
Das erinnert an die grossartige Szene in Asterix, als der besoffene Piratenkapitän für einmal sein Schiff nicht selber absaufen lässt, als er die Gallier erspäht, sondern dem Steuermann klare Befehle gibt, wie der Kurs zu setzen sei. Befriedigt meint der Käpt’n: «So macht man das», während das nächste Bild des Comics in die Totale geht – und den absurden Zickzackkurs des Schiffs zeigt.
Hier handelt es sich aber nicht um ein fiktives Schiffchen, sondern um die – angesichts des Niedergangs der Privatmedien – immer wichtiger werdende Informationsquelle der Deutschschweiz.
Zu der kann man nur sagen: So sollte man das nicht machen.

Im Newsroom wird die stabilste Technik verbaut.