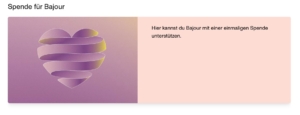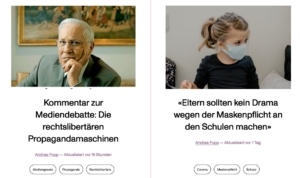Besser geht’s nicht. Serbe, Veganer, hält sich für was Besonderes. Auf ihn.
Man kann Menschen schon durch eine bösartige Auswahl des Fotos denunzieren:
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Vorsicht, bissiger Serbe …
Man kann auch einen offenbar komplexen Sachverhalt simplifizieren. Dann geht die offizielle Story so: ein «arroganter» Serbe, der auch bei seinem Tennisspiel auf eine «teuflische Strategie» setzt, meint, er sei von allen Regeln befreit.
So ein kleiner Horta-Osório, sozusagen; der VR-Präsident der CS meint ja auch, für ihn gälten keine Corona-Regeln.
Mit dieser Haltung sei Novak Djokovic nach Australien gereist. Obwohl er um seinen Impfzustand ein Geheimnis macht. Wahrscheinlich ist er ein Impfgegner, ein Verschwörungstheoretiker, ein Serbe halt, was kann man da schon erwarten.
Wäre Roger Federer nie passiert. Der lebt schliesslich bescheiden, zurückhaltend, nett, ist aus Teflon gemacht. Kann für so ziemlich alle Produkte gleichzeitig werben, unser Roger.
Hier komme ich, Bahn frei, dachte Djokovic sicherlich, bis ihn die australische Einwanderungsbehörde eines Besseren belehrte. Jetzt sitzt der Trottel in einem Quarantänehotel, während ganz Serbien mordlüsterne Drohungen ausstösst.
Wieso sollte man sich von der Realität eine tolle Vorurteils-Story kaputtmachen lassen? Es ist offenbar so, dass sowohl der ausstralische Bundesstaat Victoria wie auch der Turnierveranstalter Djokovic grünes Licht gegeben haben. Als Genesener sei die Einreise kein Problem, welcome.
Sahen die Grenzer anders, und schwups, schon ist’s eine Affäre, in der es um Gesichtswahrung und Kneten von Emotionen geht.
Viele Spieler beantragten eine Ausnahmebewilligung, nicht nur Djokovic
Insgesamt haben laut Tennis Australia immerhin 26 Spieler am Turnier eine Ausnahmebewilligung und eine Befreiung von der Impfpflicht beantragt.
Geradezu lyrisch wird «The Australian»: «Djokovics Trotz bedroht seine Odyssee, der Beste zu sein», titelt das Blatt. Er stünde «am Rande der Endgültigkeit und am Pranger des Spotts».
Mit dieser Aktion werde sein Vermächtnis unwiderruflich zerstört, behauptet die Zeitung. Häme auf allen Kanälen ist ihm tatsächlich sicher. Hunderte von arroganten Spott-, äh Sportjournalisten geben ihm den guten Ratschlag, doch einfach wieder nach Hause zu fliegen, sich nicht so anzustellen und überhaupt, sich endlich impfen zu lassen.
Dass ein Tennisstar wie Djokovic, ein kleiner Konzern mit Entourage, eng getaktetem Zeitplan, sicherlich nicht einfach so 15 Stunden nach Australien fliegt, um dort mal zu schauen, ob man ihn rein- und spielen lässt, ist zwar offenkundig, würde aber die Möglichkeiten für Häme und Spott deutlich mindern.
Einer haut bei solchen Themen furchtbar gerne auf die Kacke
Richtig auf die Kacke haut wie meist bei solchen Themen Enver Robelli. Vielleicht sollte Tamedia die Berichterstattung über den Balkan nicht einem Mitarbeiter mit, nun ja, Migrationsgeschichte, überlassen. Denn Robelli geht es offensichtlich weniger um die Aufklärung der Leser, mehr um die Abarbeitung eigener Vorurteile.
Über die Abschiedsreise der deutschen Ex-Bundeskanzlerin durch den Balkan zeigte er sich «irritiert», denn: «Merkel umarmt die Autokraten». Da war er aber noch sanft gestimmt. Der gebürtige Kosovare leistet gegenüber Kroatien einen gewaltigen Beitrag zur Völkerverständigung:
«Kroatiens Präsident als Provokateur: Er poltert gerade wie ein Betrunkener – gegen Minister und Bosniaken».
Ein besoffener Präsident, da hat die nüchterne Merkel Schwein gehabt. Auch die Sache mit dem Osmanischen Reich hat Robelli nicht vergessen: «Der Westen darf vor Erdogan nicht einknicken.»
Aber zur Höchstform läuft Robelli bei der Affäre um Djokovic auf. «Serbische Krawallpresse», schimpft Krawallant Robelli, «Belgrader Hetzblatt», hetzt Robelli. «Selbstverständlich hätten die aufopferungswilligen Serben 1389 in der Amselfeld-Schlacht gegen die Osmanen die ganze westliche Zivilisation gerettet», behaupte ein verpeilter «ultranationalistischer Pseudohistoriker» in seinen «Machwerken», die Djokovic promote.

Dabei sollte Robelli wissen, das die historische Wahrheit über dieses Gemetzel – wie meistens – viel komplexer ist, feststehende Tatsache hingegen, dass die Serben tatsächlich aufopferungsvoll gegen das Osmanische Reich in die Schlacht zogen.
Dann diagnostiziert Robelli bei den Serben «Grössenwahn», «verletzten Stolz» und überhaupt «krude Ansichten». Kein Wunder:
«Schwurbler Djokovic geniesst eine ungewöhnlich grosse Narrenfreiheit.»
Dabei sähen wir nun den «tiefe Fall eines grandiosen Tennisspielers».
Die bittere Wahrheit ist aber: Robelli verbreitet hier ungebremst seine kruden Ansichten, die mit dem Versuch, dem Schweizer Publikum die unglaublich komplizierte jüngere Geschichte des Balkans zu erklären, null zu tun haben. Besoffener Präsident, ein Volk im Grössenwahn, Hetzblätter, ein Sportler als Schwurbler.
«Wer in diesen Tagen die serbische Krawallpresse liest, der wähnt sich kurz vor einem Weltkrieg.» So leitet Robelli sein Schmierenstück ein. Dabei ist er selbst recht verpeilt: Wer diesen Artikel aus seiner Feder liest, der wähnt sich tatsächlich in den schlimmsten Zeiten von Hetzern und Schwadroneuren und verantwortungslosen Demagogen.

Deutschsprachige Krawallpresse, 1914 …
Wieso ein angebliches Qualitätsmedium wie der «Tages-Anzeiger» so etwas publiziert, ist unverständlich. Nein, ist eine Schande.
Ein Kommentarschreiber bringt die niedere Gesinnung, in der dieser Artikel entstand, auf den Punkt:
«Bitte in dieser Angelegenheit das Wort Serbe oder Serbien rauszulassen. Er ist als Djokovic hingegangen und nicht als Serbe. Auch die verrückten Nationalisten aus Serbien, sowie seinen Vater nicht mit Serbien in Kontext bringen, nur weil sie Bürger des Landes sind. Serbien verdient diesen Kontext nicht, sowie keine andere Nation den Kontext zu Ausreissern unter ihren Bürgern verdient.Damit setzt ihr sie mit mir und anderen Leuten, die diese Stempel zufällig mit der Geburt erhalten haben, in das gleiche Boot. Weder er noch Federer vertreten mich, noch identifiziere ich mich mit ihnen, auch wenn sie die selben Pässe wie ich haben. Mit diesem Stempel setzt ihr euch auf die gleiche Ebene wie die, über die ihr hier berichtet, das ist der Schweiz nicht würdig.»
Nein, weder der Schweiz noch einem sogenannten Qualitätsorgan, das dafür noch Steuergelder erwartet.