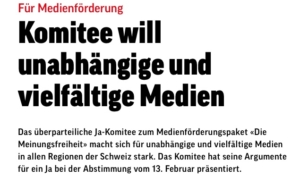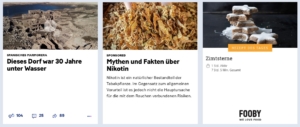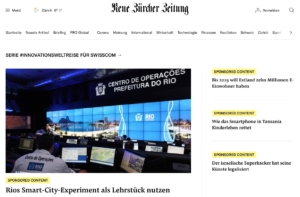Man kann dem SoBli (fast) alles verzeihen. Mit einer Ausnahme.
Wir tun mal so, als hätten wir noch nie etwas vom Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss gelesen. Und wollen uns nur an der Sprachbeherrschung einer Literaturgrösse laben. Denn Literatur hat sicherlich auch auf dem Boulevard nichts mit Littering zu tun.
Wir werden gleich mit dem ersten Satz auf Moll eingestimmt: «Auch in diesem Jahr erwartet uns eine schwierige und traurige Weihnachtszeit.» Das erinnert zwar an den Beginn eines Schulaufsatzes, aber das steigert sich sicherlich noch.

Neue Position, gleicher Blick. (Bildzitat Screenshot SoBli).
Wir hoffen nicht umsonst, schnell wird das Dichterwort dunkel: «Wenn das Virus im Körper eskaliert, versagen oft die besten Methoden der Wissenschaft.»
Aber gut, auch Jean Paul war verdammt schwer zu verstehen. Nun legt Bärfuss eine Fährte aus, sozusagen ein Ariadnefaden, die ihn zum eigentlichen Thema führen soll. Man spricht da unter Literaturwissenschaftlern von einem Leitmotiv. Hier ist es das Erbgut. Das besimme auch, wie schwer die Corona-Erkrankung sei, weiss der Litterat. Um zu verallgemeinern: «Früher stehen alle vor der Frage, die das Erbe stellt.» Könnte da ein «oder später» fehlen? Aber vielleicht verstehen wir zu wenig von literarischer Verkürzung. Oder handelt es sich gar um eine Apokope? Also im weiteren Sinne, wohlgemerkt.
Wenn das Erbe an der Türe klingelt, oder so
Nun, welche frühe Frage stellt uns das Erbe? Das beantwortet der Dichter aus eigenem Erleben, denn auch sein Vater starb (nein, nicht an Corona, steht zu vermuten). Und hinterliess ein schweres Erbe, das leicht ausgeschlagen werden konnte.
Unser Beileid, aber wie geht’s mit dem Leidmotiv weiter? «Gebäude, die mit Asbest isoliert wurden, sind wertvoll und gleichzeitig tödlich giftig.» Ach was, wieso sollen sie denn wertvoll sein? Aber gut, nur nicht grübeln, riet schon Gotthelf, das wollen wir beherzigen. Denn jetzt kommt’s:
«Genau gleich wie gewisse Kunstsammlungen. In Zürich vergiftet eine einschlägige Erbschaft die Stadt, verseucht Institutionen und Beziehungen. Schöne, kostbare Gemälde machen die schlimmsten Verbrechen lebendig, Vertreibung, Raub und Genozid. Emil Bührle, ein Krimineller, raffte sein Vermögen aus Leid und Tod zusammen. Ein Schatz, der sich aus dem Verbrechen nährt, eine teuflische Mischung: Wer damit in Berührung kommt, ist auf immer krank und vergiftet.»
Hilfe, wir gestehen: Wir sind damit in Berührung gekommen. Wir waren schon im Kunsthaus, das hoffentlich nicht auch noch mit Asbest verseucht ist. Das ist nun ein Paukenschlag, ein Zornesblitz, darüber sollten wir Zürcher nun aber mal richtig nachdenken.
Falls wir dabei auf Abwege geraten, Bärfuss führt uns an die Wurzel des Grauens:
«Aber das geht nur, wenn wir gleichzeitig über das Allerheiligste nachdenken. Oh Privateigentum! Oh Sacerdotium der bürgerlichen Welt! Dir gehört unsere Verehrung und unser Vertrauen! Unangetastet stehst du in den Stürmen der Gegenwart!»
Aber leider – horribile dictu – Fremdwörter sind Glücksache. Sacerdotium, ist uns das peinlich, einen preisgekrönten Dichter zurecht weisen zu müssen, bedeutet Priestertum oder das Reich der geistlichen, kirchlichen Gewalt. Wahrscheinlich meinte Bärfuss Sanctuarium. Aber wer sind denn wir, beckmessern zu wollen. Nur, nicht nur Jean Paul beherrschte Latein …
Aber zurück zum Text.Wir Kurzdenker dachten immer, dass es selbst in der Schweiz viele Möglichkeiten gibt, das Privateigentum anzutasten, bis hin zur Enteignung. Schön, dass wir von diesem Irrtum befreit werden.
Wem gehören die Wolken? Die Antwort kennt nur der Wind
Aber ein tief Blickender, selbst wenn das im SoBli geschieht, ist damit noch nicht auf dem Grund der Fragen angelangt: «Das Privateigentum ist heilig, also unerklärlich und unerklärbar. Was kann ein Mensch sein Eigen nennen?»
Denken wir kurz selber nach. Vernunft? Intelligenz? Logik? Sprachbeherrschung? Stringenz? Respekt? Anstand? Das kann hier alles nicht gemeint sein, will uns deuchen. Denn der Schriftsteller fängt ganz woanders an: «Unterschiedliche Güter weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. Ein Grundstück ist nicht dasselbe wie ein Regenschirm oder eine Aktie.»
Wohl wahr, sagen wir da, ganz geplättet von so viel Weisheit, die kostenlos auf uns regnet. Apropos regnen, nun wird’s wieder dunkel wie bei Hölderlin im Turm: «Wem sollten die Wolken, der Regen und der Wind gehören? Das Wetter mag unterschiedlich sein, aber für uns alle gibt es nur ein Klima.»
Es bleibt ein Wechselbad der Gefühle, darf man einem Literaten vorwerfen, dass er etwas sprunghaft ist? «Wie man mit den Risiken der Vererbung umgeht, macht uns die Evolution vor, nämlich mit Sex.»

Muss man erst mal drauf kommen …
Hoppla, plötzlich nimmt uns der Dichter im Triebwagen der Evolution mit. Nicht ohne uns weiterer Erkenntnisse teilhaftig werden zu lassen: «Lebewesen können sich vegetativ, parthenogenetisch vermehren. Erdbeeren, Blattläuse und Bambushaie halten es so.»
Gut, dass wir das wissen. Aber, dadurch unterscheidet sich der wahre Literat vom Möchtegern, wir kehren zum Leitmotiv zurück, also zur Bührle Sammlung. Denn Sex teile das Erbgut durch zwei, weiss der Hobbygenetiker, dadurch werde das Risiko halbiert. Öhm, also bei nicht rezessiven Genen, die beide Elternteile aufweisen, nicht wirklich. Aber wir wollten doch nicht grübeln.
Die Lösung für die Bührle Sammlung? Teilen
Was, oh Dichter, was hat das nun mit der Ausstellung im Kunsthaus zu tun?
«Wenn es um Erbprobleme geht, lautet die Lösung also teilen. Heute wird das Vermögen aus der Erbschaft privatisiert, die Schulden und der Müll aber werden sozialisiert, und die Sammlung Bührle folgt genau diesem Muster. Die Öffentlichkeit übernimmt die Passiven, die Aktiven bleiben bei der Familie. Es ist im Interesse aller Beteiligter, dieses wertvolle und kontaminierte Erbe gemeinsam zu tragen.»
Das ist eine wunderbare Schlussfolgerung, eine eines Büchner würdige Übertragung von genetischen Erbvorgängen ins reale Kunstleben. War Büchner nicht angehender Arzt? Das ist doch sicherlich eine raffiniert versteckte Anspielung darauf.
Das muss es auch sein, denn – wir bitten um Nachsicht wegen unseres Unvermögens – bei der Bührle Kunstsammlung kann das ja nicht ganz stimmen. Ausser, die 203 Bilder im Kunsthaus Zürich wären Müll. Und welche Aktiven sollen denn bei der Familie bleiben? Weiss Bärfuss überhaupt, was der Unterschied zwischen Aktiven und Passiven ist? Eher nicht, will uns deuchen, aber wer sind wir denn.

Passiver Müll oder toxisches Erbe?
Wie soll denn nun, so zwischen Aktiven und Passiven, das wertvolle und kontaminierte Erbe gemeinsam getragen werden? «Es gibt Lösungen», weiss der Dichter. Nur verrät er die nicht. Wir hätten da in aller Bescheidenheit eine zu bieten: regelmässige Lesungen aus seinen Werken in der Ausstellung. Das vertreibt garantiert das Publikum, womit die Bilder nicht länger kontaminieren können.














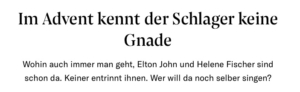
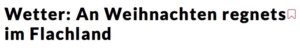
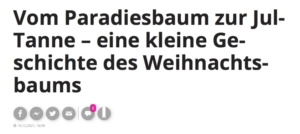




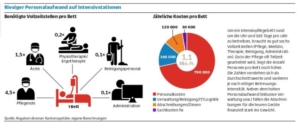

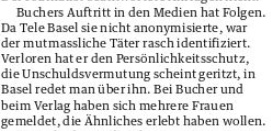






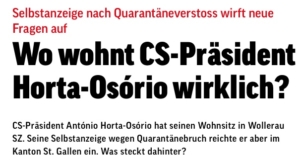






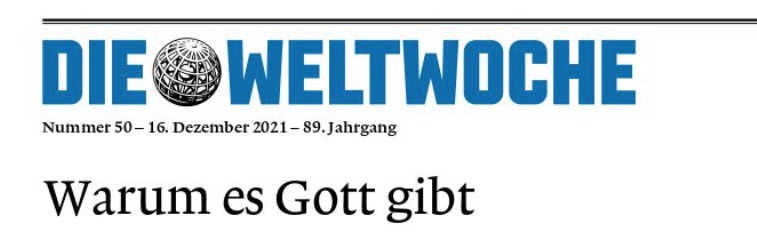












 ZACKBUM denkt scharf darüber nach, diesen Service auch anzubieten. ZACKBUM durum cogitat de hoc quoque ministerio oblatum. Genau, wenn schon, dann natürlich gleich auf Latein. Wir nähern uns nun aber bereits dem ersten journalistischen Höhepunkt:
ZACKBUM denkt scharf darüber nach, diesen Service auch anzubieten. ZACKBUM durum cogitat de hoc quoque ministerio oblatum. Genau, wenn schon, dann natürlich gleich auf Latein. Wir nähern uns nun aber bereits dem ersten journalistischen Höhepunkt: