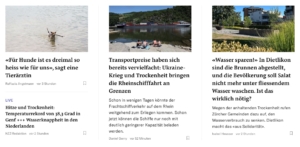Kuba ist weit weg
Erschütterndes Niveau der Auslandberichterstattung bei Tamedia.
Am 5. August veröffentlichte der Redaktor der «Süddeutschen Zeitung» Benedikt Peters den Artikel «Ans Eingemachte. Auf der sozialistischen Karibikinsel öffnet nach vielen Jahren wieder eine Marmeladenfabrik. Doch den eklatanten Mangel kann das nicht überdecken», vermeldete der Recherchierjournalist, der für solche Analysen überqualifiziert erscheint: «Stammt aus Mönchengladbach und ist immer wieder gern im Rheinland, wo er inzwischen eine zauberhafte Nichte hat», vermeldet seine Autorenseite.
Diese News hat Peters natürlich nicht etwa vor Ort recherchiert, sondern im Internet. Denn schon vor einigen Wochen berichteten diverse spanischsprachige Medien innerhalb und ausserhalb der Insel darüber. Also kalter Kaffee aufs Brötchen, sozusagen. Aber nicht so alt, dass ihn Tamedia nicht nochmal aufwärmen würde.
Nach zehntätiger Bedenkzeit überrascht das Haus des Qualitätsjournalismus am 15. August mit diesem Artikel:

Einfach einen schlechteren Titel drüberkleben, den Lead etwas einschweizern, schon hat die Auslandredaktion ihres Amtes gewaltet. Wir vermissen nur einen fäustelnden Kommentar des Auslandchefs Christof Münger. Aber vielleicht kommt der noch.
Nun ist das Abschreiben spanischer Quellen die eine Sache. Das Recherchieren von zusätzlichen Fakten eine andere. Peters will einen Einblick in die Lebensmittelkosten geben. Ein Karton Eier koste inzwischen 1200 Pesos. Auf dem Schwarzmarkt. Das ist noch einigermassen realistisch, der Durchschnittspreis liegt bei 1000 Pesos für 30 Eier. Auch den Preis für einen Liter Speiseöl hat Peters korrekt gegoogelt: 700 Pesos.
Was dem fernen Kuba-Kenner allerdings entgangen ist: bis heute existiert noch die sogenannte «Libreta», eine Rationierungskarte, auf der Grundnahrungsmittel wie Reis, Bohnen, Zucker, Salz, Speiseöl oder Milchpulver für Kinder sowie spezielle Diätnahrung für Schwangere oder Chronischkranke zu staatlich subventionierten Preisen abgegeben werden. Zwar in bescheidenen Quantitäten, aber dafür kostet das alles den Kubaner kaum mehr als 50 Pesos.
Natürlich machen solche Zahlen nur Sinn, wenn man sie mit den Einkommen vergleicht. Und da hat Peters schwer danebengehauen beim Googeln. «Eine Ärztin», also wohl auch ein Arzt, verdiene «5000 Pesos im Monat». Da würden Ärztinnen und Ärzte aber eine Flasche Rum aufmachen, wäre das so. In Wirklichkeit oszilliert das Jahresgehalt zwischen 13’000 bis maximal 40’000 Pesos.
Wir betreten ganz dünnes Eis mit einer Angabe zum Durchschnittseinkommen in Kuba. Denn statistische Angaben sind auf der letzten Insel des Sozialismus eine ziemlich schmutzige kapitalistische Erfindung. So etwas wie ein statistisches Jahrbuch gibt es nicht, den Zahlen, die gelegentlich aus der Staatsbürokratie heraustropfen, kann man glauben – oder auch nicht. Aber sagen wir mal rund 1000 Pesos im Monat. Welche Kaufkraft haben die nun? Wenn wir den Wechselkurs zur weiterhin inoffiziellen Zweitwährung US-Dollar nehmen, entspricht das etwas mehr als 8 Dollar.
Nun weiss Peters noch, dass «seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre und dem damit einhergehenden Wegfall der sozialistischen Wirtschaftshilfe Kuba in einer Art Dauerkrise» stecke. Auch das ist Unsinn; es gab die «spezielle Periode in Friedenszeiten» bis zur Jahrtausendwende, als in Venezuela eine linke Regierung an die Macht kam und die Rolle der Sowjetunion übernahm. Bis sie selbst vor ein paar Jahren in existenzielle Probleme geriet und die brüderliche Unterstützung zurückfahren musste.
Das und der Zusammenbruch der zweitwichtigste Deviseneinnahmequelle Tourismus durch die Pandemie treiben inzwischen Kuba an den Rand. Bis zu 18-stündige Stromausfälle im brütend heissen Sommer, mitverursacht durch ständige Ausfälle der angejahrten Ölkraftwerke. Versorgungsprobleme aller Art, Kleptokratie, Schlamperei, Korruption, Behördenversagen wie im Fall des Grossbrands eines Tanklagers in Matanzas, bei dessen Bekämpfung 17 Feuerwehrleute starben, das sind die wahren Probleme Kubas heute.
Peters sieht da ganz andere Ursachen: «Schuld an der Misere sind verunglückte Wirtschaftsreformen der Regierung ebenso wie US-Sanktionen, die zum grossen Teil noch unter Ex-Präsident Donald Trump beschlossen wurden.» Der zweite Grund ist die ewige Entschuldigung des Regimes für hausgemachtes Versagen. Abgesehen davon, dass die US-Sanktionen seit Jahrzehnten in Kraft sind. Eine fruchtbare subtropische Insel, die über 80 Prozent ihrer Nahrungsmittel importieren muss, darunter auch Zucker (und bis vor der Revolution Nettoexporteur von fast allem war), es braucht keine weiteren Zahlen, um das krachende Versagen der Revolution in der Landwirtschaft und in der Wirtschaft zu belegen.
Seit dem Tod des charismatischen Fidel und dem Rückzug seines Bruders Raúl Castro von öffentlichen Ämtern sieht man zum ersten Mal immer wieder Protestaktionen der Bevölkerung. Trotz drakonischen Strafen von bis zu 12 Jahren für die blosse Teilnahme an einer Manifestation gelingt es dem Regime nicht, solche Zeichen des zunehmenden Unbehagens zu unterdrücken.
Mit einem hat Peters dann allerdings wieder recht: alleine in den letzten Monaten haben über 140’000 Kubaner ihre Insel fluchtartig verlassen. Vor allem Jugendliche sehen keinerlei Zukunftsperspektive mehr und haben eigentlich nur einen Wunsch: nix wie weg.
DAS ist offenbar auch der unermüdlich arbeitenden Auslandredaktion von Tamedia aufgefallen. Denn, wozu gibt’s das Digitale, wieso nicht einen schlechten Titel durch einen anderen ersetzen und den Lead noch etwas umformulieren? Merkt doch keiner (leider doch). Also sah die Einschenke nach wenigen Stunden dann so aus:

Weg mit der Konfi im Titel, aber der Inhalt bleibt gleich …
Kuba ist kompliziert – und faszinierend. Oberflächliche und uninformierte Ferndiagnosen, aufgezäumt an einer völlig unwichtigen Ankündigung der möglichen Wiedereröffnung einer Marmeladenfabrik, sind eine Schande für ein Qualitätsorgan, das für solche Leistungen aus dritter Hand auch noch Geld verlangen will. Ein solcher Bericht ist keinen Peso wert.
Der Blöd-«Blick» verstolpert sich allerdings schon beim Setzen eines korrekten Titels, Luft nach unten ist immer:

Vielleicht hätte Erklärungsnot nicht mehr auf die Zeile gepasst, also wurde das Wort passend gemacht …