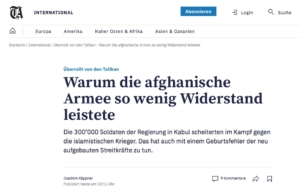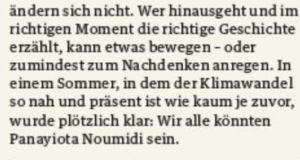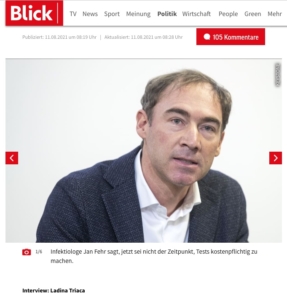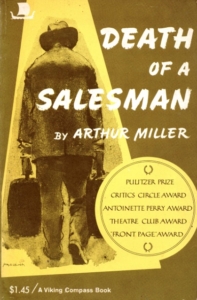Zur Erinnerung: das war ein Titel aus der Qualitätszeitung SoZ. Hier dient er für die Sammlung von Bescheuertem.
Man muss so dreinschauen, um richtig Schwachsinn erzählen zu dürfen:

Der dunkle Seher mit dem grimmigen Blick.
Denn Verpackung ist alles, wenn der Inhalt nichts ist. Der Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss, in jeder Beziehung das Symbol für den Niedergang von Literatur, Preisvergabe und Kultur, darf mal wieder im Organ für die gebildeten Stände, für tiefes Nachdenken und hohes Niveau, Gedankengänge tieferlegen:
«Raven Saunders hatte Glück. Während der Olympischen Spiele starb ihre Mutter.»
Völlig egal, in welchem Zusammenhang der Schrumpfkopf diesen Satz für den «SonntagsBlick» formulierte: nie bedauerten wir mehr, dass der Titel «Schriftsteller» nicht aberkannt werden kann. Wir hingegen hatten Pech: Bärfuss hat weiterhin keinen Schreibstau.
Mangels anderer Objekte für Beschimpfungen geht es Bärfuss diesmal ums IOC, um das Olympische Komitee. Das habe seinen Sitz «in einem Land auch, mit dem es nicht nur viele Werte, wie etwa die Neutralität, sondern auch manche Funktionäre und sogar die Soldatinnen teilt.»
Tief sei das Dichterwort, dunkel und raunend. Für uns Normalsterbliche nicht leicht zu durchdringen oder zu verstehen. Das ist doch der Sinn der Dichtung seit Platon und so. Aber Bärfuss ist nicht nur Dichter, dabei nicht dicht. Sondern auch noch Rechtsgelehrter. Doch, diese Disziplin beherrscht er auch (man beachte das dichterisch nachgestellte «auch»), was bei der Fülle seiner sonstigen Fähigkeiten vielleicht etwas unterging:
«Die Reglemente für die Olympischen Spiele, festgehalten in der Charta, gehen weit darüber hinaus und untersagen den Sportlerinnen und Sportlern, ihr Recht auf freie Meinungsäusserung wahrzunehmen. Nicht nur in der Schweiz ist dies ein Grundrecht. Und ein Vertrag, der verlangt, auf dieses oder einen anderen Grund zu verzichten, ist nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch sittenwidrig und damit ungültig. Art. 27 ZGB definiert: «Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.»»
Wir wissen nun, dass die Jurisprudenz echt Schwein gehabt hat. Denn in erster Linie vergeht sich Bärfuss an der Sprache, an der Logik und am argumentativen Essay. Wenn wir uns schreckensbleich vorstellen, dass er sich am Rechtsstaat vergreifen würde, wird uns ganz anders.
Immerhin, wenn Bärfuss seine seherischen Fähigkeiten bemüht, darf gelacht werden. So sah er schon italienische Zustände bei der Corona-Pandemie in der Schweiz um der Ecke lauern; also Chaos, Leichenberge, schlimm. Traf nicht ein, aber wer sehen kann, kann’s nicht lassen:
«Tokio ist vorbei, aber nach den Spielen ist vor den Spielen. Und die Kritik wird lauter.»
Nun gut, es soll in der Schweiz ausgezeichnete Hals-Nasen-Ohrenärzte geben, wirklich wahr.
Aber bevor ärztliche Kunst zum Einsatz kommen kann, schwingt sich Bärfuss wie in jeder seiner SoBli-Kolumnen zum abschliessenden Crescendo auf:
«Im nächsten Februar werden Soldatinnen und Soldaten der Schweizer Armee ihren Dienst fürs Vaterland im fernen Peking leisten. Offizielle Vertreter der Schweiz werden damit Teil der chinesischen Propaganda, werden Werbung machen für deren Verletzung der Menschenrechte und für den Genozid an der uigurischen Minderheit. Die jungen Menschen werden für den Kommerz und autoritäres Regime instrumentalisiert. Der militärisch-industrielle Komplex, der die totale finanzielle, politische und sportliche Macht in seinen Händen hält und ihnen sogar die Grundrechte nimmt, zwingt sie, zu diesem Unrecht zu schweigen.»
Oh, ihr Tellensöhne (und -töchter), beruft Euch auf Art. 27 ZGB und erhebt die Stimme gegen solches Unrecht.
Vertraut den seherischen Fähigkeiten des Dichters. Der männlichen Kassandra, der leider niemand glaubt.
Denn auch für die Zukunft der Schweizer Zivilgesellschaft hat Bärfuss nur dunkle Aussichten anzubieten: «Drei Lebenshaltungen werden die Post-Covid-Gesellschaft prägen: die Genusssucht, die Verzichtskultur und jene, die alles der Wirtschaft unterordnet.»
Wir gestatten uns nur ermattet die Frage: wie kann ein Verlagshaus im Ernst annehmen, dass es Konsumenten gibt, die für einen solchen Unfug, der gurgelnd durch das Regenrohr in den Boden sickert, Geld ausgeben wollen?

Schwund herrscht leider überall, auch in der SoZ
Aber auch Qualitätsmedien leiden unter Schwund. Schwund an allem. Platz, Gehirnschmalz, Themen und Kompetenz. Wenn dir gar nichts, aber wirklich nichts einfällt als Blattmacher, was machst du dann? Richtig geraten, dann machst du das hier:

Oder die vierte Welle ist zu hoch. Oder das Aufmerksamkeitsdefizit …
Inhalt, Aussage, Relevanz, Newswert? Egal, eine Seite der «SonntagsZeitung» ist gefüllt, uff.
Aber oh Schreck, nach der vollen Seite droht die nächste leere Seite, nur unzulänglich mit einem der seltenen Inserate gefüllt. Also gut, dann halt nochmal:

Die Buzzwords vereint: Corona, SVP, Angriff.
Geradezu ein Geniestreich. Nochmal Covid, diesmal in Verbindung mit dem Feindbild SVP. Uff. Aber, alte Blattmacherregel, nach der vollen Seite ist vor der leeren Seite. Nun, da hilft nur noch ein Trend. Also ein kleiner Trend mit einem riesengrossen Foto:

Ist das noch Korrekt-Deutsch?
Das nimmt ZACKBUM allerdings persönlich, denn wir sind weder Agglo-Jungs, noch fahren wir das ohne Helm, noch sind wir Jungs:

Unser Chopper, Frechheit aber auch.
Das ist das Dienstfahrzeug von ZACKBUM, allerdings schon ein Jahr in Betrieb. Sind wir nun die Vor-Trendsetter? Einfach ohne Agglo und Jungs?
Was macht der Blattmacher, wenn er Covid, Agglo und Trend durchhat? Er verzweifelt? Fast; er ruft in den Raum: wo bleibt das Klima? Nein, bitte nicht mehr den Bericht, der ist inzwischen älter als das Gewitter von vorgestern. Aber Klima, Berg, Schweiz, da muss doch etwas gehen.
Geht doch:

Es gibt noch mutige Tellensöhne.
Geröllbrocken, Gezimmertes, ein trutziger Gemeindepräsident, uns Ogi, die beruhigende Nachricht, dabei dachten wir schon, dass Kandersteg selbstmordgefährdet sei. Uff.
Gibt es sonst noch News aus aller Welt, womit kann man den Leser in der Sonntagshitze kalt abduschen? Mit einer brandneuen, geradezu Waldbrände verursachenden Erkenntnis:

Datum anstreichen: seit dem 15. August weiss das die Welt.
Dabei muss auch die SoZ vorsichtig herumeiern:

Ich weiss nicht, was soll ich bedeuten …
«Soll fallengelassen haben»; ist natürlich blöd, wenn der «Tages-Anzeiger» dieser Ente nachwatschelte und kräftig Erregungsbewirtschaftung betrieb. Bloss: kommt halt davon, wenn man sich dem modernen Recherchierjournalismus verschreibt. Man sitzt in seinem Käfig im Newsroom und lässt sich von einem gelinde gesagt eher merkwürdigen Studenten anfüttern.
Geht noch einer? Also gut, ein letzter:

Früher gab es nur BB, heute sogar BBB, dank der SoZ.
Die News ist alt, aber wenn man schon so einen schönen alliterierenden Titel hat, auch eine brandaktuelle Fotografie, dann kann man doch nicht widerstehen, den Leser mit Aufgebackenem zu langweilen.

Wir entlassen mit der NZZaS in diesen Montag
Wo bleiben Gerechtigkeit und die NZZaS? Also gut, eine Duftnote am Schluss. Die gute Nachricht zuerst: die schreibende Sparmassnahme, der Wortschnitzer aus dem Pensionärswinkel, also Rentner Müller macht Pause bei der Medienkritik. Die schlechte Nachricht: deshalb ist Aline Wanner dran.
Die wurde von einer Fotografie berührt, die auch auf der Frontseite der NZZ war. Eine alte Frau, Panayiota Noumidi, 81,vor der Feuerhölle auf der griechischen Insel Euböä. Sicherlich anrührend, ein lucky shot, wie man das in der zynischen Fotografensprache nennt. Das hat Wanner berührt, geradezu angefasst, überwältigt. Das ist schön für sie, dass sie zu solch menschlichen Regungen fähig ist.

Nur: wozu und wohin bewegen Medien?
Aber wenn Gefühle regieren, hat der Denkapparat Sendepause:
«In einem Sommer, in dem der Klimawandel so nah und präsent ist wie kaum je zuvor, wurde plötzlich klar: Wir alle könnten Panayiota Noumidi sein.»
Öhm, also da sagen wir mal: nein. Wir alle könnten Charlie Hebdo sein, wir könnten sogar Fidel sein, wir können mit #metoo dabei sein, auch beim #aufschrei oder gar #netzcourage und gegen Hass und Hetze im Internet hassvoll hetzen.
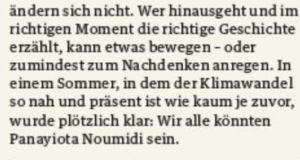
Es darf peinlich berührt gelacht werden.
Aber, Pardon, Noumidi könnten wir nicht sein. Wanner nicht, ZACKBUM nicht, ihre Leser nicht, unsere Leser nicht, Sorry, geht nicht, blöder Schluss, falsches Pathos, statt ins Erhabene abgeschwirrt ins Lächerliche geplumpst. Kommt halt davon, wenn es keine anständige Medienkritik mehr gibt.