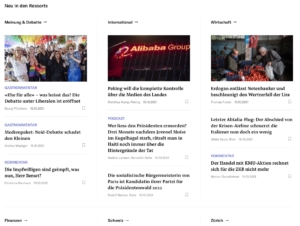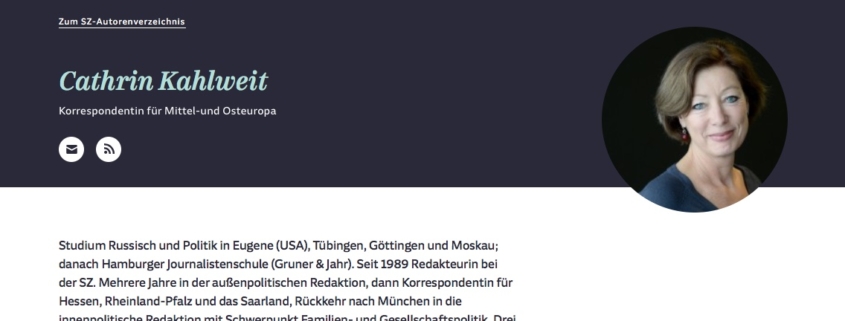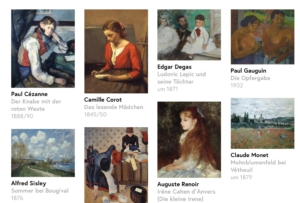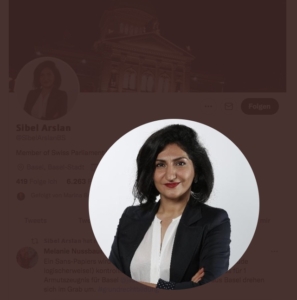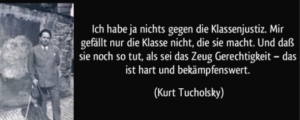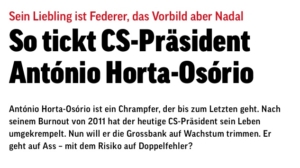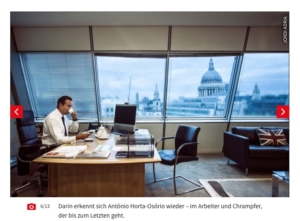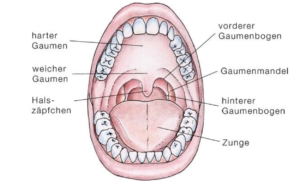Obduktion der NZZaS
Papiermangel, schlecht, Hirnschmalzmangel, schlechter. Hintergrund ohne Hintergrund.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
«Hintergrund» ist eine Ansage, von der NZZaS sowieso. Tiefe Denke, gute Schreibe, bereichernde Gedanken, Einsichten und Ansichten. Könnte man meinen, sollte man erwarten, wird aber in der aktuellen Ausgabe zum Witz. Wenn man die Definition von Freud heranzieht, dass ein Witz aus einer enttäuschten Erwartungshaltung entsteht.
Im «Hintergrund» vom 17. Oktober gibt es genug Witze für eine ganze Comedy-Show. Allerdings wohl nicht absichtlich zubereitet.

Witz 1: Markus Bernath sinniert aus der neutralen Schweiz heraus, wie denn die EU mit Polen und Ungarn umzugehen habe. Denn das wissen die vielen Eurokraten in Brüssel und Strassburg nicht, daher leiht ihnen Bernath ungefragt seinen Sachverstand. Der rät der EU, die beiden Staaten schlichtweg rauszuschmeissen.
Nur: wie? Den Ausschluss, Rausschmiss ist – «nicht vorgesehen», muss er einräumen. Aber, Bernath weiss Rat: gingen die beiden bösen Buben nicht freiwillig, «könnte die Kommission sie auch aus der EU mobben». Echt jetzt? Das rät die NZZ, tapfere Verteidigerin des Rechtsstaats?
Aber wie auch immer, Bernath weiss: «Die EU sitzt am längeren Hebel.» Na, dann geht’s doch, «was nicht heisst, dass sie die Auseinandersetzung nicht auch verlieren könnte». Ja was denn nun?
Die Polen und die Ungarn wollten gar keinen Austritt, weiss Ferndiagnostiker Bernath, also dann doch:
«Die Union kann das Kräftemessen mit den Rechtspopulisten in Warschau und Budapest deshalb gewinnen.»
Gewinnen, verlieren, kann man so oder so sehen.
Ach, und was ist eigentlich der Anlass für die guten Ratschläge? «Dass nationales polnisches Recht über dem Eu-Recht stehen soll, kann die Kommission nicht akzeptieren.» Damit liefert Intelligenzbestie Bernath gleich noch den besten Grund nach, wieso die bilateralen Verhandlungen am Schluss gescheitert sind. Denn wie Polen kann das auch die Schweiz nicht akzeptieren.

Witz 2: Laut Martina Läubli sei die Bestsellerautorin Sally Rooney «verstrickt im Widerspruch». Ja in welchem denn? In einem? In vielen, diagnostiziert Läubli. Zunächst: Rooney will zurzeit keine hebräische Übersetzung ihres dritten Werks, angeblich als Protest gegen die «Unterdrückung der Palästinser durch den Staat Israel». Kann man machen, wo ist da ein Widerspruch?
«Rooney lehnt die Übersetzung ihres Buches in Russland oder China nicht ab, wo die Menschenrechtsverletzungen aber ähnlich schlimm sind.»
Super, wird Israel freuen zu hören. Abgesehen davon ist das kein Widerspruch, sondern einfach eine Entscheidung einer Autorin. Aber nun müsse sich Rooney fragen lassen, donnert Läubli, «ob sie denn eine Antisemitin» sei. Mag sein, dass Flachdenker sie das fragen, aber wieso auch Läubli?
Damit nicht genug, die Autorin sei durch ihre Bestseller reich geworden, «gleichzeitig bezeichnet sie sich als Marxistin». Will Läubli damit wirklich sagen, dass zwischen dem Verwenden der marxistischen Ideologie und Reichtum ein antagonistischer Klassenwiderspruch bestehe? Nein, so ein primitives Unterstellen wollen wir einer NZZaS-Autorin nicht unterstellen. Oder doch?
Weitere «Widersprüche»: Die Autorin steure nun «auf Bürgerlichkeit zu». Ist ja furchtbar widersprüchlich, wie äusserst sich das denn? Hui, sie hat sich «ein Haus gekauft und ihren langjährigen Partner John Prasifka geheiratet». Das sind ja nun schreiende Widersprüche. Oder hört man hier Dummheit schreien?

Witz 3: Damit nicht genug, in der Medienspalte, zu der die einstmals angesehene Medienkritik der NZZ geschrumpft ist, ist wieder Felix E. Müller dran, der Garant für die alte Wahrheit, dass was nicht viel kostet, nicht viel wert ist.
Denn der schreibende Rentner will an zwei Beispielen aufzeigen, dass es in der Schweiz gar nicht so einfach sei, einen «Skandal» herbeizuschreiben. Hämisch mokiert er sich über die Bemühungen von Tamedia, unterstützt vom Schweizer Farbfernsehen, das mit den «Pandora Papers» zu probieren. Ging nicht, während die NZZ, Selbstlob stinkt nie, lediglich «die Hintergründe dieser internationalen Kampagne» ausgeleuchtet habe. Während die «Weltwoche» das Ganze sogar als «substanzlose Pseudo-Aufregung» bezeichnet habe. Wie ZACKBUM übrigens auch, aber diese Plattform mag Müller nicht.
Die WeWo hingegen habe versucht, die «amourösen Eskapaden nach Kräften» zu skandalisieren. Dann habe sich das Wochenmagazin darüber beschwert, dass die anderen Medien «angeblich von Bersets Verirrungen gewusst, aber nicht darüber geschrieben» hätten.
«Das ist allerdings falsch»,
trompetet Müller, «haben doch alle anderen Medien das Thema aufgegriffen». Doch die «Sache» halt nicht «als dramatisch» beurteilt. Was nun allerdings völlig falsch ist. Kein Medium – obwohl es in Bern die Spatzen von den Dächern pfiffen – hatte die «Sache» vor der WeWo aufgenommen. Und am Erscheinungstag dauerte es bis in den Abend, bis sich die übrigen Medien von ihrer Schockstarre erholt hatten und zögerlich, sofort Partei ergreifend, darüber berichteten.
Damit wird die Kolumne von Müller auch nicht zum Skandal. Aber er hat einen weiteren Sargnagel ins hoffentlich bald erfolgende Ende seiner Schreibkarriere geschlagen.
Vorher meldet er sich allerdings in der gleichen Ausgabe nochmals auf einer Doppelseite zu Wort. Das ist dann im Vergleich zu einer Kleinkolumne ein grosser, doppelter Sargnagel.
Fortsetzung folgt sogleich.