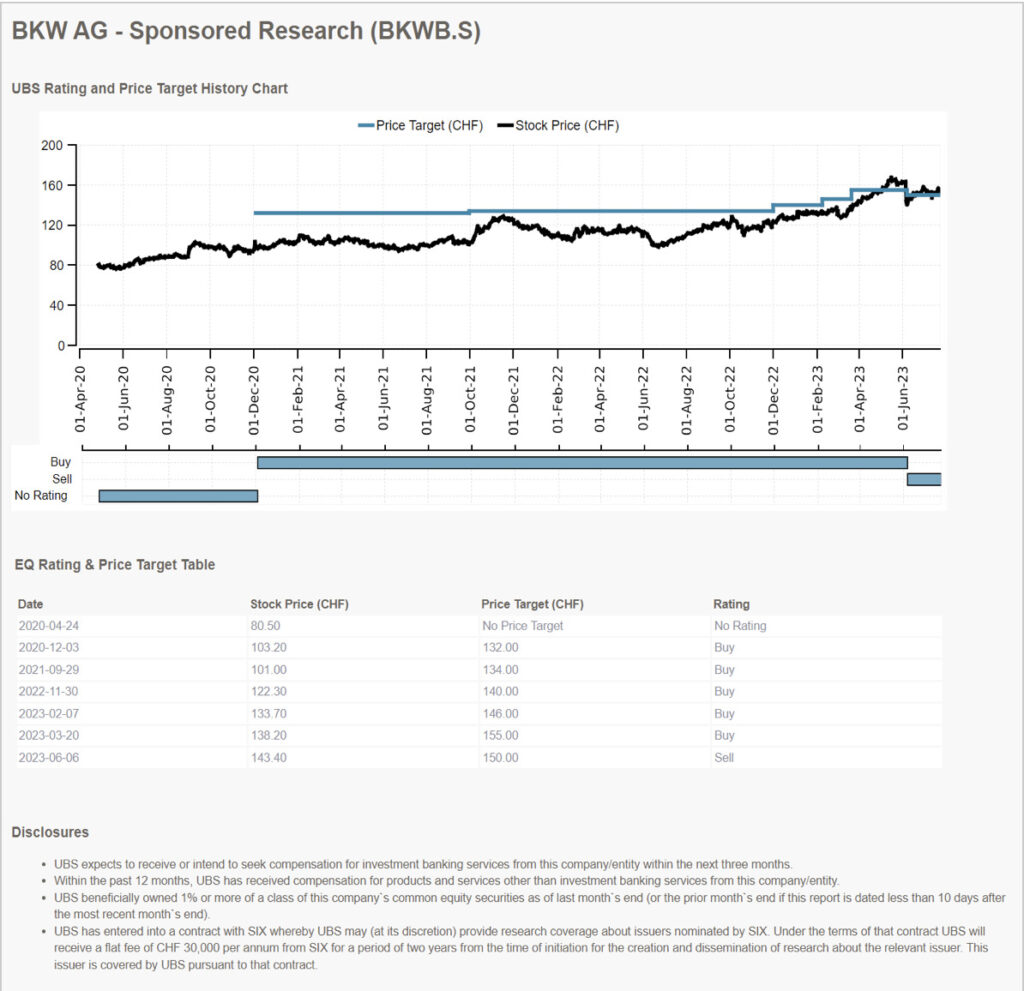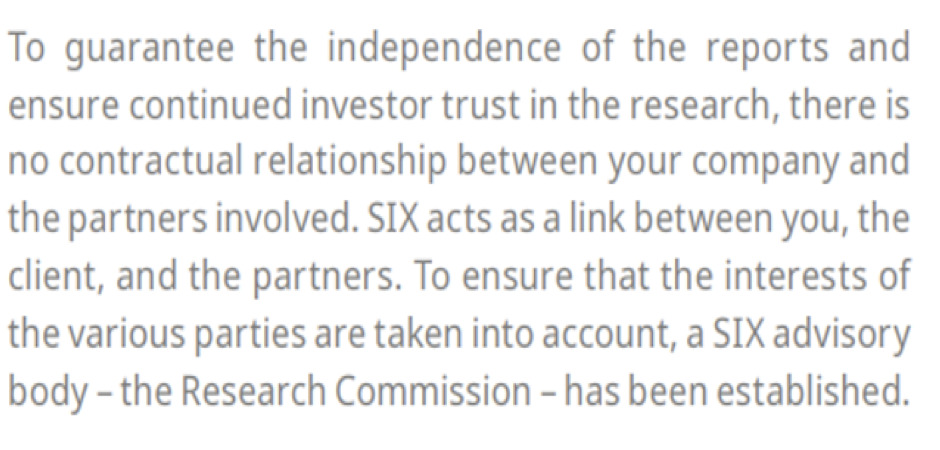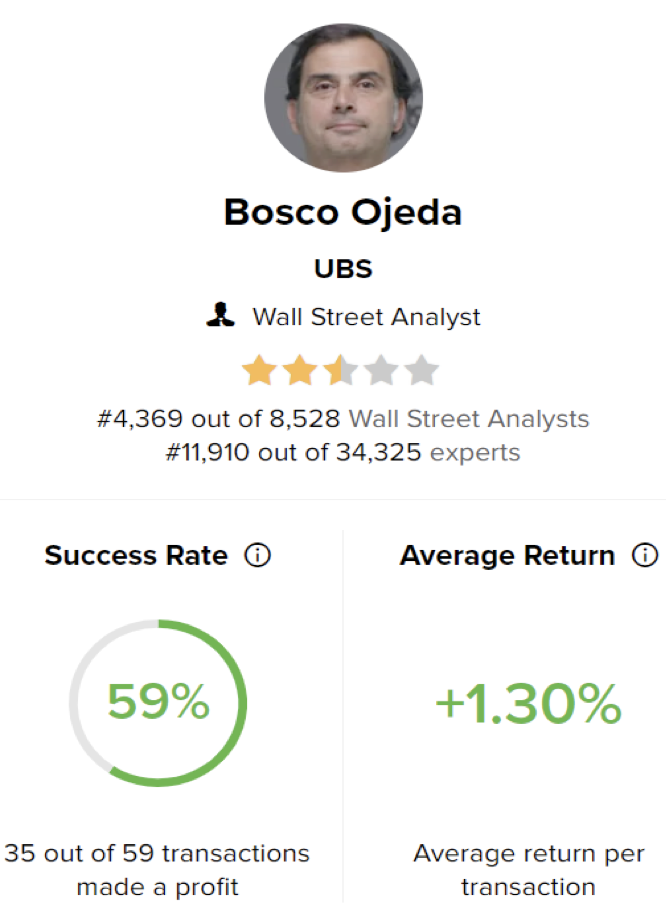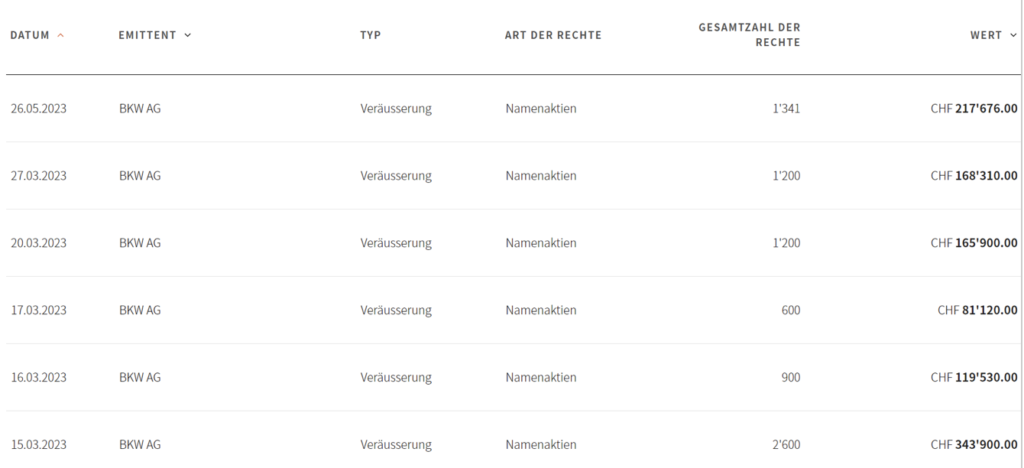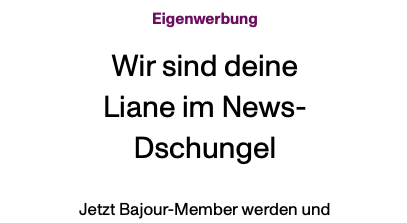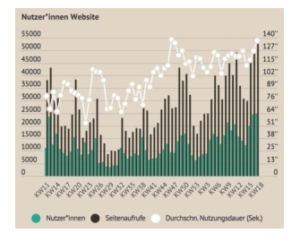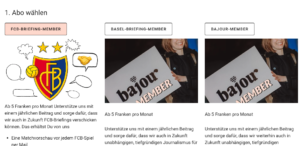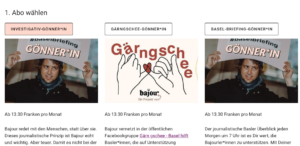Tamedia gründelt und gründelt.
Unten, wo der journalistische Bodensatz ist, der Schlamm des Gesinnungsjournalismus, wo Interviews geführt werden, in denen sich zwei Gleichgesinnte in den Armen liegen – genau da ist Tamedia zu Hause.
Bei Tamedia ist ein «Essay» ein selbstverliebtes Gestammel. Ein «Kommentar» eine sprachlich holprige Realitätsfehldeutung. Eine «Reportage» das Gespräch mit drei Meinungsträgern vom Lehnsessel aus. Und ein «Interview» immer wieder die Begegnung zwischen einem Stichwortgeber und einem Schwafeli, der unkritisiert und ungehemmt all das sagen kann, was er schon immer mal sagen wollte.
Marc Brupbacher ist eigentlich «Co-Leiter des Ressorts Daten & Interaktiv». In dieser Eigenschaft wurde er schon während der Pandemie extrem verhaltensauffällig (der Bundesrat sei «völlig übergeschnappt», mit dem damaligen Gesundheitsminister sei er «fertig»). Bis heute mopst Brupbacher gelegentlich mit Schreckenszahlen zur x-ten Corona-Variante nach, was aber – ausser ihn – wirklich keinen mehr interessiert.
Nun – es ist Sommerpause, da darf jeder alles – outet er sich als Politkenner und interviewt einen Geschichtsprofessor, der bislang noch nie öffentlich auffiel:

Damir Skenderovic forsche «seit über 20 Jahren zum Thema Rechtspopulismus und Rechtsextremismus». Das ist erstaunlich, denn erst 2004 doktorierte er, erst seit 2011 ist er Professor für Allgemeine und Schweizerische Zeitgeschichte an der Uni Freiburg. Aber Datenspezialist Brupbacher muss es doch nicht immer mit Daten so genau nehmen.
Nun hat Brupbacher eine tablettengrosse These, die er im Gespräch, also im Stichwortgeben über 10’000 A breitwalzt. Wer den Vorspann gelesen hat, kann sich eigentlich das sogenannte Interview sparen: «In Deutschland legt die AfD deutlich zu. Geschichtsprofessor Damir Skenderovic sagt, wie ähnlich die Partei der SVP ist – und warum diese als Vorbild für Rechtspopulisten in Europa gilt.»
Schon mit seiner ersten Antwort disqualifiziert sich Skenderovic als ernstzunehmender Historiker. Brupbacher fragt ihn, wieso man in Deutschland angeblich über den «hohen Wähleranteil der rechtspopulistischen AfD in Umfragen schockiert» sei, in der Schweiz aber auf die «wählerstärkste SVP gelassener» reagiere.
Da müsste ein Historiker, der die Ehre der Geschichtswissenschaft hochhalten wollte, zunächst einmal problematisieren, was der Begriff «rechtspopulistisch» eigentlich bedeuten soll, dann müsste er gegen die hier schon implizierte Ähnlichkeit zwischen AfD und SVP protestieren. Aber da es sich um zwei Gleichgesinnte handelt, kuschelt sich der Professor in der Antwort gleich an:
«Das hat historische Gründe. Deutschland hat eine andere Erinnerungskultur. Man hat verinnerlicht, was der Nationalsozialismus und seine rassistische Politik angerichtet haben, und reagiert deshalb sehr empfindlich auf den Aufstieg der AfD.»
Während Brupbacher unwidersprochen AfD und SVP in den gleichen Topf wirft, insinuiert der Professor nun, dass die AfD ihre Wurzeln im Nationalsozialismus und dessen rassistischer Politik, sprich Judenvernichtung, habe. Aber damit nicht genug, Skenderovic fährt fort:
«In der Schweiz ist das Geschichtsbewusstsein zu diesen Themen weniger ausgeprägt, dabei gab es auch einen helvetischen Faschismus. Jungfreisinnige, Katholisch-Konservative und andere politische Milieus zeigten zudem damals Sympathien für autoritäre Regimes, und der Antisemitismus war vor 80 Jahren auch in der Schweiz verbreitet. Das wird gerne vergessen.»
Das ist nun auch von hübscher Perfidie. Also in der Schweiz wird die SVP nicht so postfaschistisch wie die AfD in Deutschland wahrgenommen, weil das Geschichtsbewusstsein weniger ausgeprägt sei.
Nun stellt Brupbacher eine weitere rhetorische Frage: «Ist denn die SVP überhaupt mit der AfD vergleichbar?»
Die zunächst ausweichende Antwort: «In der Geschichtswissenschaft sprechen wir von den klassischen Parteifamilien. Es gibt konservative, liberale, kommunistische und sozialdemokratische Gruppen. Seit über 30 Jahren wird nun die Landschaft um die Rechtspopulisten erweitert, die je nach Land ihre Besonderheiten haben.»
Nun spricht allerdings kaum einer von den «klassischen Parteienfamilien». Dafür zieht der Professor im Anschluss eine Linie von Schwarzenbachs Überfremdungsinitiative von 1970 zur SVP von heute, was an Demagogie kaum zu überbieten ist.
Brupbacher arbeitet seine Stichwortliste weiter ab: «Die SVP oder auch die AfD werden manchmal als «Gefahr für die Demokratie» beschrieben. Ist das nicht übertrieben?»
Die Demokratien seien heutzutage gefestigter als in den 20er- oder 30er-Jahren, leitet der Professor seine nächste Perfidie ein: «Aber es stellt sich die Frage, was heisst Demokratie? Freie Wahlen und freie Meinungsäusserung, das institutionelle System der Demokratie sind wohl nicht bedroht. Aber was ist mit den Menschenrechten, mit dem Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft? Es geht bei der Demokratie nicht nur um das politische System, sondern auch um demokratische Grundwerte.»
Also AfD und SVP bedrohen nicht direkt die Demokratie, aber die Menschenrechte und die Schwächsten in der Gesellschaft. So belegfrei wie unverschämt.
Nächste Frage auf der Liste; wie stehe es denn mit der Zusammenarbeit mit solchen Parteien? «Es geht darum, sich von Rechtspopulisten klar abzugrenzen. Es geht um die Frage der Zusammenarbeit. Wenn man mit ihnen kooperiert und Allianzen und Koalitionen eingeht, legitimiert man ihre Anliegen.»
Allein in diesen Ausschnitten gäbe es Anlass für unzählige nötige Nachfragen, um nicht zuletzt auf Widersprüchlichkeiten und baren Unsinn in den Aussagen des Professors hinzuweisen. Darauf könnte er sich vielleicht erklären, der Leser bekäme vielleicht ein anregendes Streitgespräch serviert, das vielleicht keine bedeutende Erkenntnissteigerung beinhaltet, aber wenigstens unterhaltsam wäre.
So aber kriegt er die Bankrotterklärung eines Interviews hingeworfen, wo ein unbekannter Professor auf die dümmlichen Stichworte eines voreingenommenen Redaktors, der offenkundig mangelnde Kompetenz durch überreichlich Gesinnung kompensieren will, das Gewünschte antworten darf.
Und das soll dann eine «Forumszeitung» sein, die sich bewusst ist, dass sie durch das Duopol im Tageszeitungsmarkt dermassen meinungsmächtig ist, dass sie angeblich verschiedene Positionen zulassen will?
Es ist doch an Perfidie schwer zu überbieten, dass im aufkommenden Wahlkampf mit allen Mitteln versucht wird, die SVP in die Nähe der AfD zu rücken. Die zahlreichen und unübersehbaren Unterschiede werden plattgequatscht, durch unwidersprochen bleibende perfide Unterstellungen und Insinuieren werden beide Parteien auf ihre angeblich vorhandenen Wurzeln im Nationalsozialismus, im Faschismus, im Rassismus, in der Judenvernichtung gar zurückfantasiert.
Auch hier muss man sich wieder – vergeblich natürlich – fragen, wo denn die Qualitätskontrolle bei Tamedia bleibt. Wieso hat Brupbacher bei Abgabe dieses Interviews niemand gefragt, ob er nun «völlig übergeschnappt» sei? Ob er ernsthaft meine, dieses Gefälligkeitsgespräch genüge den primitivsten Ansprüchen an ein journalistisch geführtes Interview? Woher er sich die Kompetenz anmasse, als Datenjournalist politisch-historische Vergleiche zwischen einer deutschen und einer Schweizer Partei anzustellen? Wieso er sich einen Gesprächspartner ausgesucht habe, der einzig durch das Bedienen aller gewünschten Klischees auffällt und sich dabei keinen Deut darum schert, dass er damit seinen nicht vorhandenen Ruf ruiniert?
Das sind keine singulären Ereignisse mehr bei Tamedia. Das ist, wie man so schön sagt, ein strukturelles Problem geworden. Es sollte doch in einem meinungsbildenden Medienkonzern zumindest das Bestreben erkennbar sein, ein gewisses Niveau nicht zu unterschreiten. Aber wie sagte man früher so richtig: Tamedia, quo vadis?
Es gibt einen grossartigen Roman von Franz Jung: «Der Weg nach unten». Dieser Titel fällt ZACKBUM immer wieder spontan ein, wenn wir an Tamedia denken. Was für ein Mann, was für ein Leben, was für ein Werk. Sein erstes Buch in seiner expressionistischen Phase trug den Titel «Das Trottelbuch». Passt auch. Nun müsste man allerdings nicht nur Nora Zukker so viel erklären, dass wir es lassen.