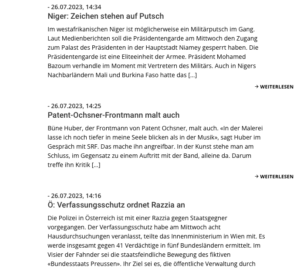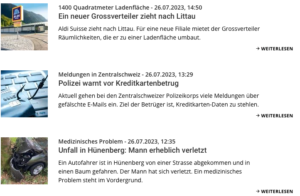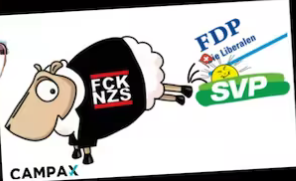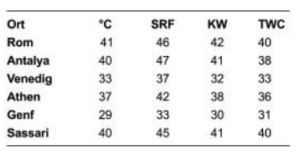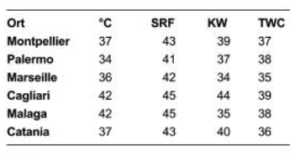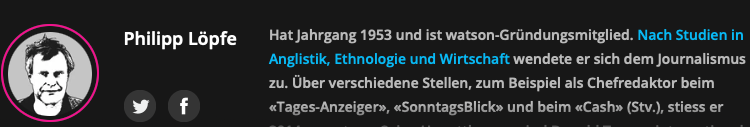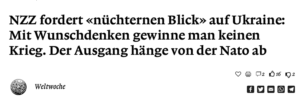Martin Walser †
Zwischen zwei Begegnungen.
Die erste Begegnung mit Martin Walser (24. März 1927 – 28. Juli 2023) fand wohl so Mitte der Siebziger Jahre an der Universität Zürich statt. Walser hatte einen Vortrag gehalten, und in den damaligen, politisch aufgeheizten Zeiten, wo jeder Schriftsteller Bekenntnisse ablegen sollte, sich kritisch zu diesem und jenem äussern müsste, wurde Walser gefragt, wieso er das nicht oder nur sehr selten tue.
«Wenn mir ein Zahn oben links wehtut, dann kann ich nicht über Zahnweh unten rechts schreiben», antwortete er, aus dem Gedächtnis zitiert. Damit setzte er sich natürlich zwischen alle Stühle damals. Das blieb auch sein Lieblingsaufenthaltsort, was ihn durchaus sympathisch machte.
Die letzte Begegnung fand vor zwei Jahren in seinem Haus statt, wo er nach wie vor wie ein Dichterfürst auf dem Stuhl thronte, unterwürfig umsorgt von seiner Frau. Er war immer noch unermüdlich produktiv, erzählte von seinem neusten Projekt, eine Art autobiographisch-erotische Rückblende, inklusive seinen Fantasien und Träumen. Seine Frau schaute leicht angefasst an die Decke.
Geistig da war er nicht mehr ganz, aber weiterhin munter und interessiert, was ihn ungebrochen sympathisch machte.
Da er es nicht mehr hört und mitbekommt, ist hier allerdings der Anlass für ein Geständnis. Seine Werke sind ziemlich spurlos an ZACKBUM vorbeigegangen. Wir gehörten auch nicht dem Fanclub Walsers an, der in der Schweiz von Matthias Ackeret angeführt wird. «Halbzeit», «Ein fliehendes Pferd», später dann seine Romane über das Thema Liebe, nun ja. Sein epischer Streit mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki; die beiden verband eine tiefe gegenseitige Antipathie.
Der gnadenlose Kritiker verriss den «Tod eines Kritikers» als «miserable Literatur», als «ein erbärmliches Buch». Dieses Gebalge machte natürlich beide noch bekannter. Die Vorwürfe waren ungerecht. Walser war ohne Zweifel ein Virtuose der deutschen Sprache, ein Schriftsteller, der diesen Namen verdient – im Gegensatz zu heutigen Wortbrockenspuckern wie Lukas Bärfuss oder Dominik Holzer, die vor Besoffenheit an der eigenen Betroffenheit kaum geradeaus laufen, geschweige denn schreiben können.
Allerdings, Walsers Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels war bemerkenswert. Er warnte 1998 davor, den Deutschen immer wieder ihre nationalsozialistische Vergangenheit vorzuhalten, das animiere nicht zum Eingedenken, sondern zum Wegschauen. Auschwitz verkomme so zur «Moralkeule». Dafür wurde er selbst fast gekeult. Aber aus heutiger Sicht, im Zusammenhang mit der Cancel-Kultur, die auch Adolf Muschg mit Auschwitz vergleicht, hatte diese Warnung etwas Hellsichtiges.
Denn jeder Blödkopf, bar jeder historischen Kenntnisse, keift schnell einmal «Nazi» oder «Faschist», wenn er eigentlich einfach «Arschloch» sagen will. Dieser Missbrauch, diese Verhöhnung der Opfer, das ist ein anhaltender, anschwellender Skandal.
Wenn ein durchaus bedeutender Schriftsteller stirbt, kommt die Stunde der Nachrufschreiber. Bei Tamedia hat das Martin Ebel erledigt, der ja einigermassen über das dazu nötige Rüstzeug verfügt. Im Gegensatz zur «Literaturchefin» Nora Zukker. Bei der NZZ darf Martin Krumbholz ran, ein durchaus valabler Nachrufer. Der «Blick» verwendet Daniel Arnet, der sich leider nicht enthalten kann, zunächst mal länglich über sich selbst zu schreiben. CH Media geht mit Bettina und Hansruedi Kugler ans Gerät, nicht ohne dass Patrik Müller auch noch kurz etwas schreiben darf. Richtige Sternstunden der Würdigung von Mensch und Werk sind allerdings nicht dabei.
Im Gegensatz zu den heutigen Modeschreibern hat Walser geschrieben, weil er schreiben musste. Weil das Beruf, Berufung, Trieb, Sucht, Liebe und Bestimmung war. Er hat die deutsche Sprache nicht missbraucht oder vergwaltigt, sondern sie geliebt und mit ihr um die bestmögliche Formulierung gerungen. Somit ist die deutsche Literatur wieder ein Stück ärmer geworden, denn es wächst nicht viel nach.