Upscaling und Downgrading
Hochpumpen und Wertigkeit runtersetzen. Interessante Methoden.
Die in letzter Zeit etwas einfallslose Uhrenmarke Swatch hat eine Idee gehabt. Sie stellte eine Plastikversion der Omega-Kult-Uhr «Moonwatch» her. Das Original-Teil kostet von 6500 Franken aufwärts, die Kopie schlappe 250 Franken.
Die Idee ist wirklich originell, denn normalerweise versuchen Prestigemarken wie Omega, die Wertigkeit und Einmaligkeit ihrer Produkte zu stützen. Denn nur so können sie absurde Preise dafür verlangen, dass sie auf ein Billigkaliber, das unter Brüdern für 80 Franken zu haben ist, ein paar Komplikationen draufschrauben, in ein edles Gewand kleiden und für ein paar tausend an die Kundschaft bringen.
Nun hat Swatch den Vorteil, dass nicht nur Omega zum gleichen Konzern gehört, sich also gegen diesen Übergriff schlecht wehren kann. Es ist aber tatsächlich ein grossartiger Marketing-Gag; wie weiland bei Apple-Produkten bildeten sich am Erstverkaufstag lange Schlangen vor den Swatch-Läden, die auch Wochen und Monate nach der Lancierung nicht viel kürzer wurden.
Was ist besser als eine einmalige Aktion? Klar, die Wiederholung der Aktion. Natürlich muss etwas variiert werden, als vergreift sich Swatch diesmal an einer weiteren Nobelmarke des Konzern, an Blancpain.

Die Taucheruhr gibt’s auch ab 6500 Franken, in Sonderedition kann das auch bis zu 25’000 hochschnellen, wenn man sie bei Weissbrot kauft. In der Swatch-Ausgabe soll sie dann 400 Franken kosten. Dafür gibt’s dann aber auch kein Quarzgeknödel, sondern ein mechanisches Uhrwerk und Wasserdichte bis 90 Meter. Und tiefer dürfte ja wohl der normale Swatch-Kunde eher selten tauchen, abgesehen davon, dass die Tauchgänge zur Titanic momentan unterbrochen sind.
Das ist also ein gelungenes Beispiel für Downgrading.
Nun kommen wir zu einem misslungenen Beispiel von Upscaling. Die Rede ist für einmal nicht von Fabian Molina. Auch nicht von Sanija wie heisst sie doch gleich. Auch Kovic kommt erstaunlicherweise nicht vor, auch nicht Regula Stämpfli, ebensowenig wie andere Nullnummern. Denn schon wieder ist die Rede von Cédric Wermuth.
ZACKBUM ist so froh, dass Helmut Hubacher das nicht mehr erleben muss. Denn dem Mann tut die völlige Abwesenheit einer sinnvollen Tätigkeit nicht gut. Überhaupt nicht gut. In der Talkshow von Roger Schawinski tastete Wermuth nämlich mal das Terrain ab. Er will in Konkurrenz mit Molina und Funiciello treten. Jawohl, er schliesse nämlich eine Kandidatur zum Abwart, Pardon, zum Bundesrat, nicht aus.
Während aber Molina und Funiciello und Jositsch ohne Wenn und Aber mit diesem Gedanken spielen oder gar schon angetreten sind, ist Wermuth geschickter. Er macht seine Entscheidung vom Ausgang der Nationalratswahlen abhängig. Geht er als grosser Sieger ins Ziel, der den Stimmenanteil der SP deutlich vergrössert hat, rechnet er sich gewisse Chancen aus. Schliesslich hat er in den letzten Monaten sichtbar an seinem Markenkern gearbeitet. Akkurat geschnittener Bart, dunkles Jacket über weissem Hemd oder Pullover, natürlich locker leger niemals mit Krawatte. Gesichtsausdruck vor dem Spiegel eingeübt. Sympathisch lächelnd oder staatsmännisch besorgt, nicht mehr verkniffen oder übellaunig.
Das nennt man Upscaling. Damit werden kleine Formate auf Breitleinwand gepimpt. Auch Frösche beherrschen diesen Trick, wenn sie ihr Blähsäcke aufpumpen, um an Format zu gewinnen.
Allerdings gibt es bei Wermuth ein Problem. Aufblähen ist gut, aber auch der Frosch schnurrt wieder zur früheren Form zusammen, wenn die Luft draussen ist. Oder auf die Politik übertragen: natürlich herrscht im Bundesrat das Prinzip Mittelmass. Aber ein gewisses Minimum an Kenntnissen, Fähigkeiten, politischem Wissen, Bildung und Prinzipien sollte man schon mitbringen.
Sonst wirkt das so, als ob eine Swatch ernsthaft eine Omega oder eine Blancpain sein möchte. Und da ist es dann sogar vom Erhabenen zum Lächerlichen nur ein kleiner Schritt. Wobei Wermuth alles andere als erhaben ist.














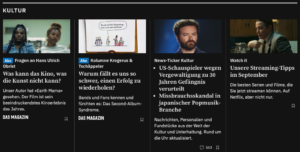 Das schämt sich auf der Homepage von Tamedia nicht, unter der Rubrik «Kultur» zu erscheinen. Im «Magazin» wurde ein Autor zu einem Kinoerlebnis befragt. Journalisten interviewen Journalisten, das ist immer das Begräbnis der Berichterstattung.
Das schämt sich auf der Homepage von Tamedia nicht, unter der Rubrik «Kultur» zu erscheinen. Im «Magazin» wurde ein Autor zu einem Kinoerlebnis befragt. Journalisten interviewen Journalisten, das ist immer das Begräbnis der Berichterstattung.





