Gute Nachrichten von Wanners
CH Media kann aufatmen. Schloss und Weinberg gehen es gut.
Man schätze sehr den «fairen Dialog» mit der Personalkommission, wird CEO Michael Wanner zitiert. Das habe dazu geführt, dass man statt 150 «nur» 140 Vollzeitstellen abbaue. Ach ja, und nach fröhlichen Weihnachten werden dann im Januar 80 Mitarbeiter auf die Strasse gestellt. Da kommt Freude an den Festtagen auf.
Dieses Desaster erklärt, wieso die Trennung vom erfolgreichen CEO Axel Wüstmann recht rumpelig erfolgte. Der wusste sich nicht anders zu helfen, als den Kamikaze-Expansionskurs des Wanner-Clans in die elektronischen Medien öffentlich in Frage zu stellen. Das kostete ihn wie wohl beabsichtigt den Job. Zuerst sollte er seinen Nachfolger, einen Wanner-Sprössling, noch einarbeiten. Dann stellte sich wohl heraus, dass das eine eher schwierige Aufgabe wäre.
Also wurde aus der vorausschauend langfristig geplanten Übergangsregelung eine Freistellung per sofort.
Am Sozialplan für die Massenentlassung werde nun nicht mehr geschraubt, lässt das Unternehmen noch mitteilen. Ach, und auf Anfrage von persönlich.com wurde bestätigt, dass die Teppichetage nicht auf Lohn und Boni verzichte. Dazu sei man gezwungen: «Lohn und Boni sind Teil der Vertragsvereinbarung, an die sich Arbeitgeber halten müssen», bedauert die Kommunikationschefin.
Ein weiterer Beitrag zu: für wie dumm hält der Wanner-Clan eigentlich seine Konsumenten und Mitarbeiter? Natürlich kann ein Unternehmen nicht einfach zugesicherte Leistungen verweigern. Aber die Versager in der Geschäftsleitung, die für dieses Schlamassel verantwortlich sind, könnten ja freiwillig ihre Solidarität mit den Gefeuerten zeigen. Oder so kundtun, dass auch sie selbst mit ihrer jämmerlichen Performance nicht so ganz zufrieden sind.
Aber bei diesen materiefremden Managern herrscht die gleiche Mentalität wie bei Bankern. Gewinn, Verlust, Drama, Vollversagen – völlig egal, satter Lohn und üppiger Bonus muss sein.
Ein Stellenschwund von 7 Prozent, das sind keine Peanuts. Nachdem bereits durch die Installation einer Zentralredaktion und die Belieferung unzähliger Kopfblätter mit einer Aarauer Einheitssauce kräftig eingespart wurde.
Auf der anderen Seite kaufte Wanner die NZZ aus dem gemeinsamen Joint Venture, gleichzeitig kaufte das Medienhaus alle Privat-TV- und Radio-Stationen auf, die erhältlich waren. Ohne es damit zu schaffen, zu einer echten Konkurrenz des grossen Bruders SRF zu werden.
Man ist v ersucht, Parallelen zum Wunderwuzzi aus Österreich zu ziehen. Aufkauf um des Aufkaufs und des Namens willen, Tele Züri, Radio 24, die 3+-Senderfamilie, diverse Lokalsender, die nun auch teilweise mit einer Einheitssauce bespielt werden. Strategie dahinter? Das Joint Venture mit der NZZ im Bereich Tageszeitungen. mit Ausnahme des Fasses ohne Boden «watson». Strategie? Dann Abkauf der NZZ-Anteile. Strategie?
«Der Stellenabbau bei CH Media ist aber weiterhin dringlich und für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unvermeidbar», tönt Filius und CEO Wanner. Wir holzen kräftig ab, auf dass der Wald gedeihe. Was an einer Massenentlassung zukunftsfähig sein könnte, das weiss wohl nur Wanner.
Zukunftsfähig wäre es, wenn die Chefetage eine Strategie ausgebrütet hätte, mit der das Wanner-Imperium zukunftsfähig würde. Das wäre dann eine echte Sicherung, auch von Arbeitsplätzen. Aber so? Beruf Tochter oder Sohn, das ermöglicht zwar den ungebremsten Aufstieg, reicht aber nicht unbedingt als Qualifikation für höhere Positionen.
So wie die UBS schon längst durchrechnete, was ihr eine Übernahme der Credit Suisse bringen würde, beschäftigen sich bei Ringier und Tamedia garantiert auch schon ein paar Nasen damit, zu welchem Preis eine Übernahme von CH Media Sinn machen würde.
Letztlich ein typisches Problem der dritten Generation in Unternehmen …







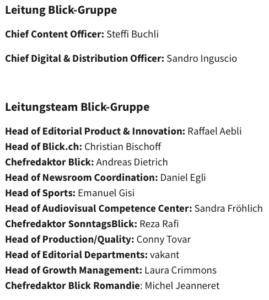














 Eine Kriegerin für Frieden auf Erden, wunderbar. Allerdings: ein typischer, weichgespülter Jubel-Artikel aus der «Schweizer Illustrierte». Aber es soll ja doch «Blick»-Leser geben, die das bunte Blatt aus dem gleichen Haus nicht lesen.
Eine Kriegerin für Frieden auf Erden, wunderbar. Allerdings: ein typischer, weichgespülter Jubel-Artikel aus der «Schweizer Illustrierte». Aber es soll ja doch «Blick»-Leser geben, die das bunte Blatt aus dem gleichen Haus nicht lesen.







